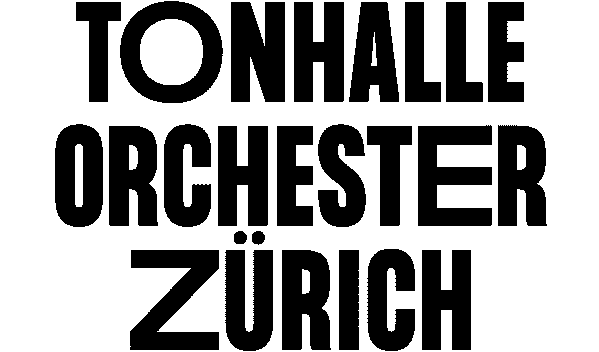Wie geht teilen auf musikalisch?
Eine Uraufführung in unserem Saisoneröffnungskonzert liefert die Antwort.
«Sharing is caring», heisst es in diesen sparfreundlichen und ökologiebewussten Zeiten immer öfter, und zu Recht: Ein geteiltes Auto schadet weniger als ein allein ausgefahrenes, ein geteilter Rasenmäher verstopft nur einen Keller, und ein geteiltes Büro kostet die halbe Miete.
Das Sharing-Prinzip hat mittlerweile zahlreiche Lebensbereiche erfasst – auch den Orchesterbetrieb. Nicht, dass die Musiker*innen inzwischen die Instrumente teilen würden; eine Geige ist nun mal kein Rasenmäher, sondern ein Ding, zu dem man als Geiger*in eine höchst innige und individuelle Beziehung hat. Aber immer öfter werden Werkaufträge von mehreren Orchestern vergeben. Und ja, man darf da durchaus ein weiteres Trendwort bemühen und von einer Win-Win-Situation sprechen. Oder, noch genauer: von einer Win-Win-Win-Win-Situation.
Zunächst einmal gewinnen die Orchester-Gesellschaften, die als Auftraggeber nur die Hälfte des Kompositionshonorars bezahlen müssen (oder, wenn mehr als zwei Klangkörper beteiligt sind, nur ein Drittel, ein Viertel, ein Achtel: Man rechne).
Zweitens gewinnt der Komponist: Denn sein Werk verschwindet nach der Uraufführung nicht gleich in einer Schublade, sondern wird zumindest ein zweites Mal gespielt. Damit steigen auch die Chancen, dass jemand es hört, der dann eine dritte Aufführung organisiert: Bingo.
Auch den Solist*innen und Dirigent*innen kommt das Sharing-Konzept entgegen. Zeitgenössische Werke sind in der Regel schwierig einzustudieren; die ganze Arbeit für eine einzige Aufführung auf sich zu nehmen käme, um im Bereich des wirtschaftlichen Vokabulars zu bleiben, einer eher ungünstigen Kosten-Nutzen-Rechnung gleich.
Und viertens profitieren im besten Fall noch einmal die Orchester – zumindest dann, wenn der Koproduktions-Partner so gewählt wird, dass es einem imagemässig nützt oder zumindest nicht schadet. Wer also zum Beispiel einen Auftrag zusammen mit den Berliner Philharmonikern vergeben kann, erhält nicht nur ein neues Werk, sondern auch ein bisschen vom Glanz des Spitzenorchesters, das zweifellos nicht mit irgendeinem B- oder C-Ensemble zusammenspannen würde.
Järvi von hier, Pahud von dort
Und hier können wir nun von der Theorie in die Praxis wechseln: Denn in dieser Saison spielen wir in der Tonhalle Zürich gleich zwei neue Werke, die wir zusammen mit den Berlinern in Auftrag gegeben haben. Zur Saisoneröffnung steht die Uraufführung von Toshio Hosokawas Flötenkonzert «Ceremony» bevor, das später in der Philharmonie aufgenommen wird; im Januar gibt es dann Erkki-Sven Tüürs Flötenkonzert «Lux stellarum», das im vergangenen Mai in Berlin aus der Taufe gehoben wurde.
Dass die Zusammenarbeit zustande kam, dürfte auch mit den Protagonisten zu tun haben: Den Solopart spielt in beiden Werken Emmanuel Pahud, Solo-Flötist bei den Berlinern und in diesem Jahr Fokus-Künstler in der Tonhalle Zürich. Und dirigiert werden sie von Paavo Järvi, der eben auch in Berlin ein gern gesehener respektive gehörter Gast ist. Auch in diesem Bereich ist es also eine geradezu lehrbuchmässige Koproduktion: Das eine Orchester stellt den Solisten, das andere den Dirigenten …
Nur das Publikum, das wird bei der ganzen Aktion selbstverständlich nicht geteilt. Im Gegenteil: Es verdoppelt sich. Win-win-win-win-win.