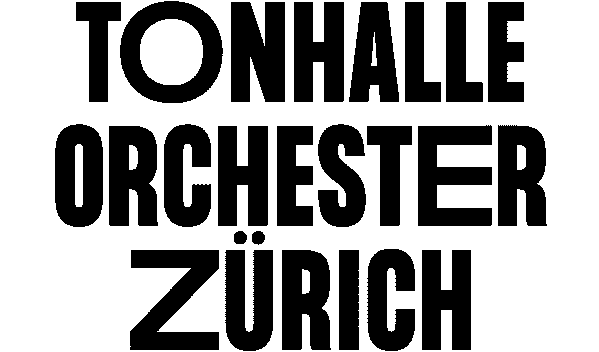Die Urkraft der Kirschblüten
Toshio Hosokawa ist der bedeutendste japanische Komponist der Gegenwart. Doch lange bevor er das wurde, zog es ihn in den 1970er-Jahren nach Deutschland. Mit «neuen Ohren» ausgestattet, entdeckte er den musikalischen Reichtum der japanischen Traditionen für sich und lässt ihn in seinen Kompositionen aufleben.
Kirschblüte, Ikebana, Tee-Zeremonie und sanft rauschende Bambuswälder: Mehr Japan-Klischee geht fast nicht. Aber wenn Toshio Hosokawa über diese Dinge spricht, mit einem verhuschten Lächeln, forschenden Augen und einer Körperhaltung, die unablässig um Entschuldigung zu bitten scheint – genau dann passiert der Zauber: Aus dem vermeintlich abgedroschenen Exotik-Idyll wird etwas Lebendiges, etwas Tiefgreifendes und Anrührendes.
Das Schöne in der Ferne
«Als Jugendlicher war ich ganz und gar von westlicher klassischer Musik, von Beethoven, Mozart und Strawinsky fasziniert», sagt Hosokawa. «Die dynamische Lebendigkeit und der gewaltige Klang des grossen Orchesters sowie der starke emotionale Ausdruck begeisterten mich. Mein Grossvater war Lehrer für Ikebana, die Kunst des Blumensteckens; meine Mutter spielte die Koto. All das fand ich eher langweilig und altbacken.»
So verliess Toshio Hosokawa mit 20 Jahren seine Heimat Hiroshima, um in Berlin einen Aha-Moment sondergleichen zu erleben. Bei einem Musikfestival wurde zeitgenössische Musik zusammen mit Musik aus Afrika, Indien, Indonesien, Persien und Korea aufgeführt – und auch mit traditioneller Musik aus Japan. «Ich hörte Musik des Buddhismus, den Ritualgesang Shōmyō, die höfische Instrumentalmusik Gagaku und auch die von meiner Mutter gespielte Koto-Musik. Damals erlebte ich traditionelle japanische Musik zum ersten Mal als ‹Musik› und fand sie schön. Mir wurde klar, dass sie ein Teil von mir ist.»
Alte Traditionen und neue Ohren
In Berlin nahm Toshio Hosokawa Unterricht bei Isang Yun, der seine Entwicklung entscheidend mitprägte. Denn Yun selbst hatte die Wiederentdeckung seiner Wurzeln zu einer neuen Ästhetik erhoben, in einer Kombination aus traditioneller koreanischer Musik und Zwölftönigkeit – es waren schliesslich die 1970er-Jahre. «Indem ich westliche zeitgenössische Musik studierte, veränderten sich meine Ohren», so Toshio Hosokawa. Sie waren nicht mehr nur ausgerichtet auf die Klassiker des Westens und die Abneigung gegenüber den musikalischen Gepflogenheiten im Elternhaus, sondern öffneten sich zunehmend für die Feinheiten der japanischen Traditionen. Doch das genügte noch nicht, entschied Klaus Huber, Toshio Hosokawas zweiter Kompositionslehrer in Freiburg im Breisgau. Er schickte Hosokawa zu einem Forschungsaufenthalt zurück in seine Heimat. Denn wie soll ein junger japanischer Komponist ein neues Stück für ein Gagaku-Ensemble und buddhistische Shōmyō-Sänger schreiben, der dieses musikalische Brauchtum nie zuvor studiert hat?
Die Begegnungen aus dieser Zeit beeinflussen Hosokawa bis heute: Dichter und Nō-Theater-Trommler, Shō- Spielerinnen und Zen-Meister – sie alle hinterliessen Spuren im Schaffen des Komponisten.
Ein Zen-Meister liess Toshio Hosokawa an seiner täglichen Schulung des Geistes teilhaben; dafür praktizierte er Kalligrafie, die Schriftkunst, die weit mehr ist als «Schönschrift». Es geht vielmehr darum, sich in einen Zustand höchster Konzentration zu versetzen, um die Schriftzeichen in einem Zug zu Papier zu bringen – unter Einhaltung aller Konventionen und gleichzeitig die eigene Persönlichkeit ausdrückend. Später dann dient die Kalligrafie der Vertiefung während einer Meditation oder ist Gegenstand der Konversation bei einer Tee-Zeremonie.
Der Weg als Ziel
Der Komponist erinnert sich, dass der Zen-Meister in seinem Beisein mit einem grossen Pinsel das Schriftzeichen DŌ («Weg») auf ein grossformatiges weisses Blatt malte. Dazu erklärte der Meister: «Der kalligrafische Vorgang bildet eine Kreisbewegung. Die auf dem Papier sichtbare Linie ist nur ein Teil der Bewegung, der unsichtbare Teil der Bewegung über dem Papier gehört auch dazu und ist eine Andeutung der unsichtbaren Welt.»
Kalligrafie und Kathedralen
Darin erkannte Hosokawa seinen eigenen «Weg», den Weg hin zu seiner «Kalligrafie des Klangs». Bereits sein Lehrer Isang Yun hatte den Vergleich mit der Kalligrafie bemüht, um die Klangtraditionen von West und Ost miteinander zu vergleichen: «Wenn in der Musik Europas erst die Tonfolge Leben gewinnt, lebt bei uns schon der Ton für sich. Man kann unsere Töne mit Pinselstrichen vergleichen im Gegensatz zur Linie eines Zeichenstiftes.»
Das sind die Fundamente zweier Klangkonzepte: «Europäische Komponisten wie Bach und Bruckner versuchten, mit Musik gleichsam eine festgefügte, massive Kathedrale zu erschaffen, in der Ewigkeit wohnt.» Seine eigene Bausubstanz wählt Hosokawa bewusst instabil – und damit auch im Einklang mit religiösen Ideen des Shintoismus, zum Beispiel der uralten Vorstellung, dass der Mensch nur ein Teil der Natur ist und alles wieder in den Naturkreislauf zurückkehrt: «Ich möchte den Ablauf von Musik als einen Fluss erleben. Der Ton wird geboren und vergeht. Er kann ohne die Existenz von Stille nicht existieren.»
Schubert und Bambushain
Es sind die essenziellen Fragen und Themen, mit denen sich Toshio Hosokawa in seinen Kompositionen mit musikalischen Mitteln auseinandersetzt: Werden und Vergehen, Mensch und Natur – über viele Jahrzehnte besonnen, auf Harmonie abzielend. Bereits in einem Aufsatz von 1995 hinterfragte er den Anspruch von Musik: «Ich hege die Befürchtung, dass [...] die Musik der Menschen ihre wesentliche Natürlichkeit verliert. In den Werken zeitgenössischer Komponisten ist irgendwie die Empfindung für die ursprüngliche Kraft der Natur verlorengegangen. » In der Musik vergangener Zeit erkennt Hosokawa diese Verbundenheit sehr wohl: «Ich liebe die Musik von Schubert sehr, besonders in der Musik aus seinen letzten Jahren [...] empfinde ich seine Musik als Urworte eines Menschen, der in tiefer Beziehung zur Natur steht, zu einem ursprünglichen, menschlichen Gesang.»
Mit seinen Kompositionen der Musik diese «wesentliche Natürlichkeit» zurückzugeben, ist erklärtes Ziel von Hosokawa. Spielarten dieser Idee sind Effekte der Bambusflöte Shakuhachi, die uns direkt in den Bambushain bringt, oder Atemgeräusche wie im kürzlich in der Tonhalle Zürich uraufgeführten Werk «Ceremony» für Flöte und Orchester. Hier tritt wieder der Zen-Meister auf den Plan, der Hosokawa einst beim Meditieren die Anweisung gab: «Langsames Ausatmen bedeutet, bis zum Tod auszuatmen, und beim Einatmen kehrt man von diesem Punkt des
Katastrophen und Kirschblüten
Doch die Harmonie dieses stets hoffnungsvollen Kreislaufs ist ins Wanken geraten: am 11. März 2011, als ein Tsunami die grösste Naturkatastrophe seit Jahrhunderten über Japan brachte. «Unser Leben ist eng mit der Natur verwoben, die in Japan unberechenbar ist. [...] Auch der Tsunami hat uns eindrücklich vor Augen geführt, wie weit sich der Mensch von der Natur entfernt hat.» Toshio Hosokawa hat mit der «Meditation to the victims of Tsunami (3.11)» ein sehr persönliches Werk geschrieben, das seinen Fragen nach dem Essenziellen im Leben und in der Musik nur noch mehr Nachdruck verleiht. Mit dem Titel «Meditation» ist wohl auch die Hoffnung verbunden, dass es ein «Zurück ins Leben» geben mag.
Das hoffnungsvollste Bild bemühte Hosokawa erst kürzlich selbst: «In Japan beginnen jedes Jahr Ende März die wunderschönen Kirschblüten zu blühen. Wir Japaner freuen uns über das Blühen der Kirschbäume, aber wir lieben auch die Atmosphäre der Zeit, in der die Kirschblüten plötzlich aufblühen und binnen kurzem abfallen und sich zerstreuen. Je kürzer die Lebensdauer der Kirschblüte, desto schöner wird sie. Ich finde Töne schön, eben weil sie vergehen. Auch unser Leben vergeht nach kurzer Zeit. Gerade deshalb ist das Leben kostbar.» Ein tröstlicher Gedanke – und aus dem Mund von Toshio Hosokawa entbehrt er jeder Banalität.
Masterclass mit Toshio Hosokawa
Workshops, Gespräche und Konzert
Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
Mo 27. / Di 28. März 2023
Mehr Infos