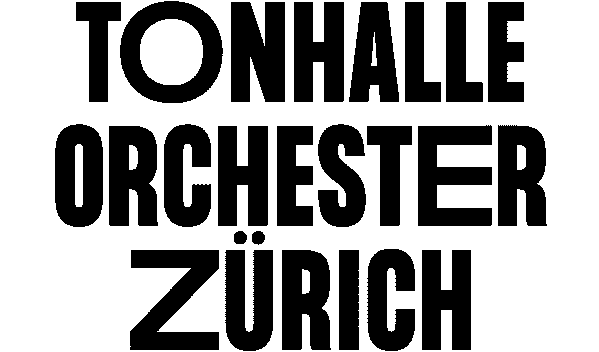Stradivaris Erben
Im norditalienischen Städtchen Cremona begann einst die Geschichte der Violine. Auch heute dreht sich hier fast alles um den Geigenbau. Wir haben zwei der rund 17O Werkstätten besucht.
«Willkommen in der wohl kleinsten Werkstatt von Cremona», begrüsst uns Katharina Abbühl, als sie die Glastür an der Piazza della Pace mitten im Stadtzentrum öffnet. Und tatsächlich, der Raum mit dem stilvollen Gewölbedach ist vermutlich höher als breit. Aber die schätzungsweise 15 Quadratmeter sind eine Welt für sich: eine, die von einem jahrhundertealten Handwerk erzählt – und von einer erfüllten Gegenwart. Auf dem Arbeitstisch liegen Holzteile und Werkzeuge, an der Wand gibt es Leisten für die Stechbeitel und Klingen. Geigenformen und Fotos liefern Vorlagen für die Instrumente, die Ausschnitte der letzten Exemplare hängen überaus dekorativ an einem «Geigenbaum ». In der Mitte des Raums, «wo es übrigens am besten klingt», vertreibt eine portable Heizung die winterliche Cremoneser Feuchtkälte.
Etwa sechs Geigen oder Bratschen entstehen hier pro Jahr, ohne Maschinen, ohne Halbfabrikate. Rund 80 Einzelteile pro Instrument werden gesägt, gestochen, gehobelt, geschliffen, geklebt, lackiert. Und jeder einzelne Arbeitsschritt braucht Geduld und ein profundes Wissen über das, was man tut. «Geigenbau kann man nicht nur ein bisschen machen», sagt Katharina Abbühl, «das ganze Leben hat mit diesem Beruf zu tun.»
Dass die 1968 geborene Bernerin dieses Leben gerade in Cremona führt, ist kein Zufall. Sie war als 19-Jährige auf der Suche nach einem Ausbildungsort erstmals hergekommen, «und als ich im Hof der Geigenbau-Schule stand, war für mich klar: Hier will ich lernen». Vier Jahre dauerte der Lehrgang, der die handwerkliche Praxis mit technischer, historischer und musikwissenschaftlicher Theorie verbindet.
Danach begann eine Biografie im Zickzack: Den ersten Job hatte Katharina Abbühl in den Reparatur-Werkstätten des Instrumentengeschäfts Jecklin in Zürich, danach kehrte sie für eine Weiterbildung nach Cremona zurück, verbrachte später einige Jahre in Luzern – und richtete sich vor acht Jahren schliesslich an der Piazza della Pace ein. Man wisse ja nie, sagt sie, «aber es kann gut sein, dass ich hierbleibe». Einerseits, weil sie den Cremoneser Alltag mag (und auch den Kaffee). Und andererseits, weil nirgendwo sonst die Geschichte und die lebendige Gegenwart des Geigenbaus so eng verquickt sind.
Amati, Guarneri, Stradivari
Die Geschichte begann im 16. Jahrhundert, als hier der Geigenbauer Andrea Amati die zuvor variablen Formen und Proportionen der Streichinstrumente so weit standardisierte, dass er gelegentlich als «Vater» der Violine bezeichnet wird. Seine Söhne und Enkel führten die Werkstatt weiter, und andere «liutai» kamen dazu: Die Familie Guarneri hat in Cremona ihre bis heute gefragten Instrumente gefertigt, und auch Antonio Stradivari und seine Söhne betrieben eine überaus produktive Manufaktur.
Warum wurde gerade Cremona zum Zentrum der «liuteria»? Wenn man mit dem lokalen Rumpelzüglein von Mailand her durch die Po-Ebene tuckert, mag man sich darüber wundern. Aber zu Stradivaris Zeiten war das Städtchen mit seinen 50’000 Einwohnern eine Metropole. Durch die Lage am Fluss blühte der Handel, auch das Holz für die Instrumente wurde auf dem Wasserweg transportiert. Und offensichtlich legte man Wert auf fortschrittliches Handwerk: Der Torrazzo des prächtigen Doms ist der höchste Backsteinturm Europas, die riesige Uhr ein technisches Wunderwerk aus der Amati-Zeit.
Die Formen
Für die Form eines Instrumentenkorpus werden Schablonen verwendet. In der Cremoneser Tradition geben diese Formbretter den inneren Rahmen vor, um den die Zargen gebogen werden. Der Boden und die Decke des Korpus werden jedes Mal neu gestaltet, so können etwa die Ecken bei jedem Instrument anders geformt werden. Im französischen Geigenbau dagegen wird mit Aussenformen gearbeitet, der Korpus sieht also immer gleich aus – was eine arbeitsteilige Produktion erleichtert, weil die Teile immer zueinanderpassen.
Wie sehr der Ort die Entwicklung des Geigenbaus geprägt hat, zeigt auch ein Konfitüreglas auf Katharina Abbühls Arbeitstisch: Schachtelhalme befinden sich darin, «die hat man früher am Po gesammelt, sozusagen als natürliches Schleifpapier, das zudem keinerlei Rillen im Holz hinterlässt». Solche Details über die Arbeitsweise von Stradivari & Co. kennt man dank aktuellen Forschungen, «unter dem Lack damaliger Instrumente hat man Kieselsäure gefunden, die von Schachtelhalmen stammen könnte». Eine direkte Überlieferung des Handwerks dagegen gibt es nicht; die einst so bedeutende Tradition brach Mitte des 18. Jahrhunderts verblüffend rasch und radikal ab. Mit dem Tod von Stradivaris Söhnen und deren Nachfolger Carlo Bergonzi endete die Blütezeit des Cremoneser Geigenbaus, es entstanden neue Zentren anderswo.
Bis heute wird gerätselt, was zu diesem Bruch geführt hat. Katharina Abbühl tippt auf eine gesellschaftliche Entwicklung: «Die Instrumente von Stradivari oder Guarneri del Gesù waren schon damals Luxusobjekte. Man hat sie bei Staatsbesuchen als Geschenke mitgebracht, ganze Hoforchester wurden damit ausgestattet.» Aber dieser Bedarf war irgendwann gedeckt, und für «das Volk» waren solche Instrumente viel zu teuer. So wurde die Produktion billiger und schneller, «eigentlich ganz wie heute» – sodass die alte Cremoneser Bauweise in Vergessenheit geriet.
Neustart in schlimmen Zeiten
Erst im 20. Jahrhundert wurde sie wiederbelebt, genauer: im Jahr 1938, dank einem ebenso hochrangigen wie brutalen Faschisten. Roberto Farinacci hiess er, und ganz im Einklang mit der faschistischen Haltung wollte er das «nationale Kulturgut» fördern – also auch den Geigenbau in seinem Wohnort Cremona. Auf seine Initiative wurde die Geigenbau- Schule gegründet, die allerdings auf ziemlich kümmerlichem Niveau startete.
Die Wende kam in den 1950er-Jahren: Damals reiste Simone Fernando Sacconi, ein in die USA ausgewanderter Römer Geigenbauer und Stradivari-Forscher, für Meisterkurse an, und sein Mailänder Kollege Pietro Sgarabotto kam als Lehrer an die «Scuola Internazionale di Liuteria»: Sie stiessen das an, was der «liutaio» Vincenzo Bissolotti ein paar hundert Meter entfernt von Katharina Abbühls Werkstatt als «Wiedergeburt» bezeichnet.
Die Wölbung
Anders als bei Gitarren ist die Decke des Korpus bei Streichinstrumenten leicht gewölbt. Diese Wölbung wird sozusagen als Skulptur aus einem Brett herausgestochen: Es ist der heikelste Arbeitsschritt im Geigenbau, vieles muss stimmen, damit er gelingt. Schon zu Beginn gilt es aus Gründen der Stabilität darauf zu achten, dass die Jahrringe des Holzes senkrecht in der Wölbung stehen. Die Wölbung selbst wird dann mithilfe von Massstab und Höhenmesser ausgearbeitet.
Eine zentrale Figur dieser «Wiedergeburt» war sein Vater Francesco, der ursprünglich Holzschnitzer war, aber dann zum Geigenbau wechselte. Er war ein Schüler von Sgarabotto und Sacconi, später selbst Lehrer an der Geigenbau-Schule – und dazu der Vater von vier Söhnen, die alle Geigenbauer wurden. Zwei davon sind noch aktiv in der Werkstatt an der stillen Piazza San Paolo: der bereits erwähnte Vincenzo, der bis zu seiner Pensionierung vor ein paar Jahren ebenfalls als Lehrer wirkte, und Marco Vinicio, der die Gilde auch als Gewerkschafter vertritt und die Geschichte des Cremoneser Geigenbaus in mehreren Büchern dokumentiert hat.
Ihre Werkstatt ist deutlich geräumiger als jene von Katharina Abbühl. Der Eingangsraum ist verziert mit Holzarbeiten des Vaters, der den Weg vom Baum bis zur Violine in Reliefs geschnitzt hat. Im hinteren Zimmer hängen ein paar Geigen an einer Leine, in einem Apothekerschrank sind Gläschen und Fläschchen mit Lacken und Harzen aufgereiht. Im Raum dazwischen steht der Arbeitstisch, eine Tischlampe sorgt für gedämpftes Licht – und Vincenzo Bissolotti muss ein paar Schalter ausprobieren, bis er jenen für die Deckenbeleuchtung findet, um uns zu zeigen, warum er diese nie einschaltet: «Man sieht nichts, wenn es zu hell ist, die Strukturen des Holzes sind gar nicht mehr zu erkennen.»
Welche Strukturen ideal sind für den Geigenbau, wie die Jahrringe beschaffen sein müssen, wie man einen Stamm richtig schneidet, worauf es bei der Lagerung zu achten gilt: Darüber könnte er stundenlang erzählen. Und auch der Duft des Holzes ist ein Thema, «wir sind sozusagen unter dem Arbeitstisch des Vaters aufgewachsen und haben mit den Spänen gespielt, diesen Geruch vergisst man nie». Eine Fichte aus dem Val di Fiemme rieche ganz anders als eine vom Karersee, «das ist kein Witz, meine Schüler haben mich einmal getestet mit drei verschiedenen Fichtenstücken, und ich habe alle richtig lokalisiert».
Geigenbau, das wird auch in der Werkstatt der Bissolottis klar, ist nicht irgendein Job, «das ist eine Liebe». Sie umfasst alles, was dazugehört – die Geschichte, die Stadt, die Musik, das Handwerk. Es sei ein sehr intimes Handwerk, sagt Vincenzo Bissolotti, ein sehr persönliches: «Obwohl wir alle mit denselben Formen arbeiten, erkennt man an vielen Details, wer ein Instrument gebaut hat.»
Hören und fühlen
Aber was macht denn nun diese klassische Cremoneser Schule aus, die 2012 in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen wurde? Für Katharina Abbühl ist es das Ganzheitliche des Prozesses, die Langsamkeit: «Wenn der Korpus bereits geschlossen ist, wird er akustisch noch einmal überprüft und überarbeitet, das macht man nirgendwo sonst.» Wie das funktioniert, verrät sie nur ihren Schülerinnen und Schülern. Doch eigentlich könne man es gar nicht so genau erklären, es gehe darum, mit Ohren und Händen Unregelmässigkeiten zu entdecken – «es passt, dass ‹sentire› auf Italienisch sowohl ‹hören› als auch ‹fühlen› heisst».
Für Vincenzo und Marco Vinicio Bissolotti geht es auch um die Individualität der Instrumente, «jedes sieht etwas anders aus». Das Ziel sei nicht glatte Perfektion, sondern Persönlichkeit: «Ein Instrument muss nicht allen gefallen, es muss zunächst einmal uns gefallen.» Selbst bei den Violinen von Guarneri del Gesú gebe es manchmal Details, die nicht ganz sauber ausgearbeitet sind, «aber dort, wo es drauf ankommt, hat er enorm viel Zeit investiert». So viel Zeit bringen längst nicht mehr alle «liutai» auf, es sind nur noch wenige, die nach klassischer Cremoneser Art bauen: vielleicht zwanzig, schätzt Vincenzo Bissolotti, «sechs oder sieben sind hier in der Stadt, die übrigen weltweit verstreut».
Das bedeutet, dass in Cremona bei weitem nicht nur in diesem Stil gebaut wird, sondern auch in vielen anderen. Rund 170 offizielle Werkstätten gibt es in der Stadt, die heute mit 70’000 Einwohnern nicht wesentlich grösser ist als zur Blütezeit: eine einzigartige Dichte von «liuterie», die einem sofort auffällt, wenn man durch die Strassen und Gassen geht. Hinter vielen Fenstern wird gearbeitet, an den Türglocken liest man neben italienischen auch deutsche, englische oder japanische Namen.
Wie viele davon profitieren von der Marke Cremona? Wie viel Folklore und Nostalgie prägen diese zweite Welle des Geigenbaus? Natürlich gebe es Spreu zwischen dem Weizen, sagt Katharina Abbühl, «manche Violinen sehen aus wie Bonbons, alle gleich». Doch insgesamt sei die Qualität in verschiedenen Stilen hoch, und die Szene sei lebendig und echt, «das ist nicht nur zum Schein». Man kennt sich, tauscht sich aus, «ich gehe fast jeden Tag mit jemandem Kaffee trinken». Zwar sei die Konkurrenz bei so vielen Werkstätten gross, «aber gerade wegen dieser Menge kommen viele Musikerinnen und Musiker hierher, um Instrumente zu testen». Der eine kauft dann hier, die andere dort, «insgesamt ist es gut für alle, dass wir nicht nur mit Zwischenhändlern zu tun haben».
Gelegentlich ärgern sich die «liutai» auch gemeinsam, etwa über die Bürokratie, die es den kleinen Werkstätten schwer macht, Lehrlinge einzustellen. Oder über die Idee der Cremoneser Stadtregierung, die Späne als Sondermüll mit den entsprechenden Entsorgungsgebühren zu klassifizieren. Da wehrte sich dann Marco Vinicio Bissolotti als Gewerkschafter: «Ich habe ihnen gesagt, wenn schon sei das Edel-Abfall – naturbelassenes Holz, ganz ohne Chemie.»
Der Lack
Liegt das Geheimnis der Stradivaris im Lack? Immer wieder werden solche Vermutungen angestellt, aber die befragten Geigenbauer*innen schütteln den Kopf im Unisono. Da gebe es keinerlei magische Ingredienzien, sagt Marco Vinicio Bissolotti, «die alten Geigenbauer kauften denselben Lack, den damals auch Möbelschreiner verwendeten». Vermutlich war es ein Lack auf Ölbasis, dessen Produktion innerhalb der Stadt brandgefährlich gewesen wäre. Katharina Abbühl und Ulrike Dederer kaufen ihre Öllacke ebenfalls ein, während die Brüder Bissolotti Lacke auf Alkoholbasis selbst herstellen. Auf den Klang hat die Wahl des Lacks kaum Einfluss. Entscheidender ist die Grundierung, bei der in mehreren Arbeitsschritten die Poren des Holzes verschlossen werden, damit der Lack nicht einsinkt.
Konzerte im Museum
Manchmal sitzt eine Gruppe von «liutai» auch um einen Tisch im Museo del Violino, das ebenfalls viel zum Zusammenhalt der Szene beiträgt. Kommt ein besonderes Instrument ins Haus, werden sie für eine Präsentation und Experten-Gespräche eingeladen. Ein grossartiges Angebot sei das, findet Katharina Abbühl, «wir können die Geigen in die Hand nehmen – zwar nur mit Handschuhen, aber immerhin». Auch sonst ist sie oft im Museum, «einfach um kurz etwas genauer anzusehen, wir haben Gratiseintritt».
Das ist ganz im Sinne von Riccardo Angeloni. Der 32-jährige Römer, der in Cremona erst die Geigenbau-Ausbildung und dann den Master in Restaurierung und Konservation von Instrumenten absolviert hat, ist seit vergangenem Jahr Kurator in diesem Museum – und sorgt dafür, dass es weit mehr als nur museal ist. Man trifft ihn im dunkelrot ausgekleideten Kernstück der Ausstellung, wo er gerade die Stradivari «Vesuvio» von 1727 aus der Vitrine holt. Eine «audizione» steht bevor, ein Kurzkonzert mit einem jungen Geiger im museumseigenen Konzertsaal. Wie jedes Wochenende haben rund 300 Leute Karten gekauft, viele Touristen, auch ein paar Einheimische.
Man sei bei diesen Konzerten sehr vorsichtig mit den Instrumenten, sagt Angeloni, «es wird genau dokumentiert, wie oft sie gespielt werden, und für die Musikerinnen und Musiker gelten klare Regeln: Kein Schmuck, die Geige nie am Korpus anfassen, nicht damit herumgehen ». Es kommen auch nicht alle historischen Instrumente des Museums öffentlich zum Einsatz. Die Stradivari «Cremonese» von 1715 etwa wird nur ganz selten gespielt, «sie ist so gut erhalten, dass wir sie so bewahren wollen». Aber auch sie wird mehrmals jährlich überprüft: «Wenn wir merken, dass ein Instrument sich irgendwie verändert, können wir restauratorisch eingreifen.»
«Dynamische Konservierung» nennt er das Prinzip: Man will die Instrumente schützen, aber im Wissen darum, dass sie eigentlich nicht in eine Vitrine gehören. Darum die Kurzkonzerte, darum die Einladungen an die Geigenbauer. Und auch sonst ist das Museum weit über die Ausstellungen hinaus aktiv: In Zusammenarbeit mit der Universität Pavia und dem Mailänder Politecnico betreibt es zwei Laboratorien, eines für die nicht-invasive Analyse von Instrumenten, das andere für akustische Fragen. Dazu wird gezielt eine neue Sammlung aufgebaut: Zusätzlich zu den historischen Instrumenten und einer Kollektion aus dem mittleren 20. Jahrhundert sind hier die Siegerinstrumente des internationalen Wettbewerbs «Antonio Stradivari» ausgestellt, der alle drei Jahre ausgetragen wird: «Da wächst eine Dokumentation heran, die für zukünftige Generationen spannend sein wird.»
Drei Institutionen
Casa Stradivari
Die Geigenbauer-Familien Amati, Guarneri und zeitweise auch Stradivari hatten ihre Werkstätten in derselben Häusergruppe im Zentrum von Cremona. Sie wurde in den 1930er-Jahren abgerissen, heute steht an dieser Stelle die im faschistischen Stil erbaute Galleria XXV Aprile. Erhalten ist dagegen ein anderes Haus, in dem Antonio Stradivari nach seiner Hochzeit mit Francesca Ferraboschi lebte und arbeitete. Es befindet sich am Corso Garibaldi 57 und wird von der 2021 gegründeten Fondazione Casa Stradivari unter der Leitung des italienisch-schweizerischen Geigers Fabrizio von Arx betrieben. Im Rahmen von Meisterkursen können ausgewählte Geigenbauer*innen während 18 Monaten in den Werkstätten im Erdgeschoss ein eigenes Streichquartett bauen.
Museo del Violino
1894 schenkte der Instrumentenhändler und Sammler Giovanni Battista Cerani der Stadt Cremona einen Teil seiner Kollektion – das war der Anlass für die Gründung des Museums. Im Laufe der Zeit kamen weitere Schenkungen und Käufe dazu; so überliess der Geigenbauer Giuseppe Fiorini dem Museum bedeutende Teile der Sammlung des Conte Ignazio Alessandro Cozio di Salabue, der Stradivaris letztem Sohn und Erben Paolo neben Instrumenten auch zahlreiche Werkzeuge abgekauft hatte. Das Museum befindet sich seit 2013 an der Piazza Marconi und verfügt mit dem Auditorium Giovanni Arvedi über einen eigenen Konzertsaal.
Scuola Internazionale die Liuteria
Die Geigenbau-Schule befindet sich in einem historischen Gebäude an der Via Colletta 5 im Zentrum von Cremona. Weitere Ausbildungsmöglichkeiten gibt es u.a. im deutschen Mittenwald oder in Brienz im Berner Oberland.
Von Cremona nach Zürich
Eine Bratsche in dieser Sammlung stammt von der Geigenbauerin Ulrike Dederer, die den Wettbewerb 2012 gewonnen hat. Sie ist eine gute Freundin von Katharina Abbühl, sie war Schülerin von Vincenzo Bissolotti – und hat in ihrem Garten in Zürich Oerlikon eine eigene Geigenbauwerkstatt aufgebaut. Die Box aus Fichtenholz ist ungefähr gleich klein wie das Atelier an der Piazza della Pace, und auch hier wird alles in Handarbeit gemacht: ohne Fertigteile, ohne maschinelle Hilfe; nur den Lack kauft Ulrike Dederer ein, wie einst die alten Cremoneser Meister.
Auch die Formen, die sie als Vorlage für ihre Instrumente nimmt, stammen von diesen. Und das Holz kommt meist von einem Baum, den sie vor Jahren zusammen mit Kollegen gekauft hat. Er stand im Trentino, also jener Region, in der einst die historischen Cremoneser Geigenbauer ihr Material besorgten. Es sei schon erstaunlich, sagt sie: «In allen Bereichen haben sich die Dinge im Laufe der Jahrhunderte enorm entwickelt. Aber im Geigenbau sind die Vorbilder aus dem 17. Jahrhundert immer noch massgebend.»
Sind denn diese Vorbilder erreichbar? Ja, meint Ulrike Dederer, «wir haben das Wissen und das handwerkliche Können, um heute genauso gute Instrumente zu bauen wie die alten Meister». Dabei geht es nicht ums Kopieren; «auch wenn ich die alten Formbretter verwende – was ich daraus mache, ist mein Instrument. Es ist meine Hand, meine Interpretation, meine Ausarbeitung.» Das Einzige, was einem neuen Instrument fehlt, ist der Mythos. Auch darum hat sie als Violoncellistin so gut Geige spielen gelernt, dass sie ihre Violinen und Bratschen ausprobieren kann, «sie sollen wirklich bereit sein, wenn ich sie jemandem zeige». Denn wenn eine heutige Violine nicht sofort gut klinge, lege man sie wohl rascher wieder zur Seite als eine Stradivari.
Das bedeutet allerdings nicht, dass die Arbeit mit dem Verkauf eines Instruments zu Ende sei – das gilt in Oerlikon ebenso wie in den Cremoneser Werkstätten von Katharina Abbühl und den Brüdern Bissolotti. Oft kommen Musikerinnen und Musiker nach Monaten oder Jahren noch einmal in ihre Werkstatt, um Details nachzujustieren. Und sie sind willkommen: «Es ist interessant zu beobachten, wie sich ein Instrument entwickelt.»
Manchmal entschliesst man sich sogar zu einer grösseren Änderung, auch dies ganz im Sinne der Tradition: Die historischen Geigen wurden im Laufe der Jahrhunderte immer wieder den neuen Bedürfnissen angepasst. So hat Ulrike Dederer etwa bei einer Viola nach vier Jahren den Steg ausgetauscht, «danach war es ein ganz anderes Instrument». Es gehört der Bratschistin Ursula Sarnthein – und trägt zusammen mit zwei Stradivaris und einer Bergonzi-Violine dazu bei, dass die grosse Cremoneser Geigenbau-Kunst auch im Tonhalle-Orchester Zürich weiterklingt.