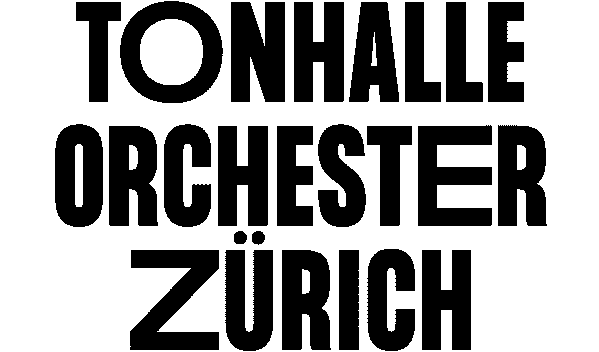Silber, Gold und Feuer
Sabine Poyé Morel ist Solo-Flötistin im Tonhalle-Orchester Zürich seit 2002. Neuerdings ist die vielfach preisgekrönte Musikerin auch Hauptfachdozentin an der Zürcher Hochschule der Künste. Ein Gespräch über Boeuf Bourguignon und Berufung, über gefrorene Schultern und einen Torero: Jenen in der Hauptrolle ihres Lebens.
«Ah oui?» Sabine Poyé Morel lächelt charmant ihr bescheidenes Lächeln, fast so, als überrasche sie Lob von allen Seiten, wenn es ihr zugetragen wird.
Heinz Holliger sagte einst, Sabine sei nicht nur eine der eindrücklichsten Flötistinnen, die er kenne, sondern auch eine geistig profunde Musikerin. Die Kritik indessen spricht von «stupender Perfektion voller Anmut», schreibt von «rasenden Läufen und flirrenden Trillern», von «Klanggesten wie Ringe im Wasser, die sich im Orchester ausbreiten». Vom «feingesponnenen Silberfaden, der alles durchwirkt» oder schlicht von Sabines «Goldklang».
Ein Orchesterkollege schwärmt von ihrer Hingabe, ihrer Musikalität.
«Ah oui?», fast so, als wäre sie selbst nicht dabei gewesen, als ihr all die Preise der renommiertesten Wettbewerbe ihres Fachs übergeben wurden: Den ersten Preis in Bayreuth. Den im japanischen Kobe, da hat sie wie in Genf einen zweiten Preis mitgenommen. Es gäbe noch jenen der ARD in München, da aber hat sie es nie versucht. Warum auch? Irgendwann kam Sabines Dirigent des Orchestre de l'Opéra national de Lorraine und sagte: Beim Tonhalle-Orchester Zürich besetze man die Stelle der Solo-Flöte neu. Sie bewarb sich, spielte wie alle hinterm Vorhang, dann davor, wurde 2002 prompt angestellt.
Aus dem Reich der Könige
Sabine ist in Tours aufgewachsen, an der Loire, an der sich Schloss an Schloss reiht. Eine Landschaft, die sie liebt und bis heute gerne besucht. Im Haus ihrer Kindheit und Jugend lebt schliesslich noch immer ihr Vater, während ihre Mutter vor einigen Jahren gestorben ist und die drei Geschwister längst in alle Himmelsrichtungen ausgeflogen sind. Sabine ist die Jüngste von vier Kindern und die Einzige, aus der eine Musikerin geworden ist. Sie übersprang eine Klasse und schloss das Gymnasium verfrüht daheim in Tours ab, um an einer Pariser Talentschmiede erneut zu maturieren und dann am berühmten Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris zu studieren.
«Ehrgeizig waren wir alle», sagt sie. «Meine Geschwister sind brilliante Leute», hochspezialisiert seien sie in ihren Fachrichtungen. Musiziert haben alle vier, waren doch beide Grossmütter Pianistinnen, Laiinnen zwar, aber auf sehr hohem Niveau. Sabine wäre wohl Ärztin geworden, wenn sie einen anderen Weg eingeschlagen hätte, wobei sich das früh als unwahrscheinlich abgezeichnet habe: Schon ihre Mutter war erstaunt, als sie die damals fünfjährige Sabine in der Oper beobachtete – Les contes d'Hoffmann, Sabine gefesselt und beseelt von der Musik damals wie heute mit 45 Jahren.
Dabei ist die Flöte gar nicht ihr Lieblingsinstrument, war es nie, sondern das Cello, wie es damals die grosse Schwester spielte. Dass man das Cello aber viel schlechter transportieren konnte, lernte sie ebenfalls früh: Mit sechs drückte Sabines Schwester ihr eine Blockflöte in die Hand und zeigte ihr während einer langen Ferienfahrt auf dem Rücksitz des Familienautos, wie man das Instrument spielte. «Es grenzt an ein Wunder, dass meine Eltern nicht durchgedreht sind», aber bei ihnen daheim sei es wirklich immer harmonisch zu- und hergegangen. Sabine erinnert sich an keinen einzigen Streit.
Klang hat Feuer transportiert
Da gehe es in der heutigen Familienwohnung in Wollishofen turbulenter zu, «es muss doch auch mal krachen, nicht? Das ist doch auch Kommunikation». Sabine lebt da mit ihrem Mann und dem gemeinsamen, 14-jährigen Sohn, der Klavier spielt, jedoch ohne berufliche Ambitionen.
«Mein Mann ist ein vielseitiger, interessanter Mensch, kein Musiker zum Glück.» Während sie grosse Sorge tragen müsse, um nicht jeden verborgendsten Winkel ihres Lebens der Musik zu widmen, sei er viel breiter aufgestellt: Ursprünglich Fotograf, inzwischen Schauspieler, arbeite er aber auch in einer Schule als Betreuer und kümmere sich um die Kinder, obendrauf handle er mit Immobilien. Kennengelernt haben sich die Beiden in Metz nahe der gemeinsamen Heimat, als Sabine im Orchestre de l'Opéra national de Lorraine Solo-Flötistin war. Man gab Bizets Carmen, Sabine spielte das prominente Solo mit der Harfe am Anfang des dritten Akts, als ihr heutiger Mann sich in der Garderobe umzog und bei sich gedacht habe: «Dieser Klang ist aussergewöhnlich, wer wohl dahinter steht?» – er sah Sabine, sie sah den Torero, den er spielte, ganz in Gold und wollte nicht mehr wegsehen. Er auch nicht. Es folgten erste Gespräche bei der Kaffeemaschine, die Dinge nahmen ihren Lauf.
Sabine ist sich bewusst, dass ihr Mann viel auf sich genommen hat, um ihr in die Schweiz zu folgen. «Das ist wahrscheinlich das Los ganz besonders von Künstlerpaaren, dass einer viel aufgibt für ein gemeinsames Leben.» Man habe im Fall von echten Chancen wenig Wahl. Als sie von der Stelle in Zürich hörte, da wusste sie, dass dies eine sei.
Die Beiden verbindet neben der Liebe zueinander, zum gemeinsamen Sohn und zur Kunst vor allem eins: Diese grosse Freude an der Kulinarik. «Franzosen halt», Sabine lacht. Nein, ein paar Scheiben Brot und Schinken, das sei kein Abendessen. Daheim gibt's meist die klassische Küche der Heimat: «Ein Blanquette de Veau, Boeuf Bourguignon, solche Sachen. Wein. Voilà.»
Kein Schlupfloch weit und breit
Oft reist das Paar ins Ferienhaus in der Normandie oder nach Paris, wo es eine kleine Wohnung in Ménilmontant, einem alten Wohnquartier im Osten der Stadt, behalten hat. Und manchmal träumt die Familie von einem Abstecher in eine Welt, in der es etwas gelassener zu- und hergeht als in Zürich. Und doch stellt Sabine mit einigem Erstaunen fest, wie sehr eine Schweizerin aus ihr geworden ist in diesen knapp zwanzig Jahren: Sie ärgert sich über schlechtes Benehmen, über die Respektlosigkeit, einen Mülleimer zu ignorieren. Dinge, die sie hier weniger finde.
Angst macht Sabine manchmal, dass sie sehr exponiert arbeitet. Dass sie sich nicht zurückziehen kann, nie. Dass sie dem Druck irgendwann vielleicht nicht mehr standhalten kann.
Körperlich müsse man sich wirklich auch Sorge tragen, aber vor den Folgen der physischen Abnutzung hat sie weniger Angst. Und dies trotz einer einschneidenden Erfahrung. Einmal nämlich, da hatte Sabine eine so genannte frozen shoulder, ganz typisch für Flötist*innen, deren schwache Stellen Nacken und eben die Schultern sind. Diese schmerzhafte Blockade kann jederzeit zurückkehren, auch wenn sie dagegen ankämpft mit einem radikalen Haltungswechsel, den sie auch ihren Student*innen an der Zürcher Hochschule der Künste nahelegt.
Die mächtigste Sucht
Gefragt, was das Geheimnis hinter ihrem Ton sei, dem besagten Silberfaden oder dem Goldklang, antwortet sie, dass sie je nach Repertoire verschiedene Instrumente zur Hand habe, dass das Silber, beziehungsweise das Gold, effektiv einen anderen Charakter hätten. Viel wichtiger aber: «Man muss eine gute Klangvorstellung haben.» Bevor sie einatme, sei ihr Körper bereit. «Wir sind wie Sänger, Mund und Kopf sind nur Resonanzkörper», deshalb sei die Haltung so zentral, innerlich wie äusserlich: Der Klang leide, wenn man gestresst sei, die Nervosität übertrage sich eins zu eins.
Die Klangkultur im Orchester sei von allen mit viel Disziplin und Leidenschaft gemeinsam erarbeitet, sie sei «raffiniert», mehr noch, in manchen Momenten so intim und gemeinsam, dass sie es körperlich wahrnehme. Sabine kann nicht genug davon bekommen: «Wenn alles um mich glüht, dann brodelt es in mir.» So wahrscheinlich sei es mit einer richtig mächtigen Sucht.
Melanie Kollbrunner