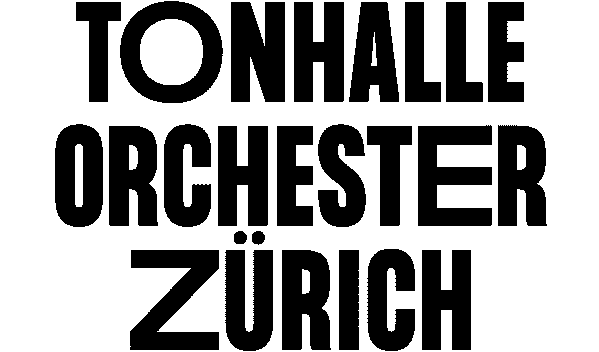Faszination, Fainting, Favoriten
Erst mit Mitte zwanzig beschloss Golda Schultz, Opernsängerin zu werden. Danach sang sie sich international an die Spitze.
Auffallende Outfits, ein charmantes Lächeln und eine unglaubliche Ausstrahlung – Golda Schultz begeistert, sobald sie einen Raum betritt. Fängt sie an zu singen, ist es wohl um jeden geschehen: Die Sopranistin überzeugt wirklich auf allen Ebenen. Liest oder schaut man Interviews mit ihr, wird aber klar, dass in ihr viel mehr steckt als «nur» eine hervorragende Sängerin. Ihr Weg in der Welt der klassischen Musik, den sie nun schon seit rund zwanzig Jahren beschreitet, war und ist spannend.
«Vollkommen versunken»
Golda Schultz wurde in Kapstadt geboren; als sie sechs Jahre alt war, zog ihre Familie nach Bophuthatswana. Ihr Vater war Mathematiker, ihre Mutter Krankenschwester. Als Kind lernte sie das Geigen- und Klavierspiel. In Grahamstown begann sie, Journalismus zu studieren, mit 19 Jahren nahm sie zum ersten Mal Gesangsunterricht. Es gab ein Schlüsselerlebnis, das ihr klarmachte, dass sie Sängerin werden würde. In einem von ihr selbst verfassten Artikel beschreibt sie dieses so: «Ich erinnere mich an einen ganz bestimmten Moment: Der gesamte Fussboden meines Studentenzimmers war mit Partituren bedeckt; irgendwo dazwischen sass ich und wollte eigentlich an einem Abschlussprojekt für mein Journalismus- Studium arbeiten. Doch statt mich mit Zeitungsartikeln und medientheoretischen Texten auseinanderzusetzen, tauchte ich in die Welt der Oper ein, versuchte, ihre einzigartige Anziehungskraft besser zu verstehen – und überlegte, wie ich meine Faszination mit anderen teilen konnte. Ich war vollkommen versunken. Auch wenn es danach noch eine Weile dauerte, bis ich endgültig meinen Weg als Sängerin einschlug, begann ich doch in diesem Augenblick langsam zu begreifen, welche Bedeutung die Musik für mich hat.»
Schock-Therapie gegen Lampenfieber
Die Muttersprachen von Golda Schultz sind Afrikaans und Englisch. Ihre Karriere begann sie allerdings am Opernstudio der Bayerischen Staatsoper. Auf Deutsch singen zu müssen, fand sie furchteinflössend. Bis heute hat sie mit Lampenfieber zu kämpfen. Kürzlich verwendete sie dafür in einem Spotify-Podcast zu dem Thema die humorvolle Bezeichnung des «Fainting-goat-Syndroms» – benannt nach der US-amerikanischen Hausziegenrasse, die bei Gefahr in eine Schreckstarre verfällt. Auf der Bühne war und ist von dieser Angst nichts zu spüren. Doch Golda Schultz ist am Anfang ihrer Karriere oftmals nach einer Darbietung in Ohnmacht gefallen.
Südafrika: Oper, Apartheid, Chöre
Im Wohnzimmer der Familie Yende in der südafrikanischen Kleinstadt Piet Retief lief der Fernseher, eine Werbung von British Airways flimmerte über den Bildschirm, und die kleine Pretty horchte auf: Diese Hintergrundmusik, was war das? Am Tag danach stellte sie die Frage ihrem Musiklehrer. «Das ist Oper», war seine Antwort, und: «Man kann das lernen.»
Die Sopranistin Pretty Yende, die mittlerweile auf allen grossen Bühnen singt, war nicht die Einzige, die es lernte. Auch die Sopranistin Pumeza Matshikiza, der Tenor Sunnyboy Dladla und unsere Fokus-Künstlerin Golda Schultz haben in Südafrika Gesang studiert – und danach den Sprung in die internationale Opernwelt geschafft.
Selbstverständlich ist das nicht. Bis 1994, bis zum Ende der Rassentrennung und der Wahl von Nelson Mandela zum Präsidenten, war die Oper in Südafrika ein weisses Privileg. Schwarze Menschen waren in den meisten Häusern weder als Angestellte noch im Publikum zugelassen, auf der Bühne oder im Orchester sowieso nicht. Dass nach dem Ende der Apartheid die Opernhäuser als Orte der Unterdrückung in die Kritik gerieten, erstaunt kaum.
Aber die Oper hat überlebt, mit neuen Protagonist* innen und neuen Konzepten. Inzwischen allerdings auch mit neuen Schwierigkeiten: So üppig der Nachwuchs ist, der an vier Musikhochschulen im Land ausgebildet wird, so rar sind die Auftrittsmöglichkeiten. Vielen Bühnen fehlt das Geld, einige mussten schliessen, zuletzt die Gauteng Opera in Johannesburg. Die Cape Town Opera in Kapstadt ist heute die einzige Kompagnie mit ganzjährigem Betrieb.
Im Zentrum dieses Betriebs steht der Chor, der das Opernrepertoire von Monteverdis «Orfeo» bis zu Strauss' «Salome» singt – und in Konzerten die klassischen Grenzen in Richtung Gospel, Jazz oder Spirituals ausweitet. Tourneen führen ihn in die früheren Townships, aber auch nach Europa, Südamerika und in die USA. 2013 wurde er bei den International Opera Awards als «Chorus of the Year» ausgezeichnet.
Und noch ein zweiter Chor ist hier zu erwähnen: die A-cappella-Formation Ladysmith Black Mambazo. Sie machte ab den 1960er-Jahren mit traditionellen Zulu-Gesängen Furore, schaffte 1986 dank Paul Simons Album «Graceland» den internationalen Durchbruch, begleitete 1993 Nelson Mandela zur Verleihung des Friedensnobelpreises nach Oslo. Bis heute ist die Gruppe ebenso weiträumig unterwegs wie ihr Opern- Pendant: Botschafter für eine reiche Kultur sind beide.
Diese Zeiten sind nun vorbei. Ihr Lösungsweg klingt drastisch: Eine «Schock-Therapie» war es, was ein Lehrer ihr empfahl. «Das war im Jahr 2002, also schon vor einer ganzen Weile. Ich hatte eine Aufführung, bin in Ohnmacht gefallen, und als ich wieder aufwachte, wurde ich ins ‹Head of the Department Office› gerufen. Mein Lehrer sagte: ‹Das war merkwürdig. Ist das schon einmal passiert?› Und ich meinte: ‹Ja. Es tut mir sehr leid, ich glaube, ich muss diesen Kurs abbrechen. Denn offensichtlich bin ich keine Performerin.› Er sagte: ‹Oh nein. Ich habe dich nur herbestellt, um dir zu sagen, dass du zu talentiert bist. Du musst dich also zusammenreissen. Wir sehen uns nächste Woche, wo du nochmal auftreten wirst. Du wirst das schaffen. Zwei Dinge können passieren: Entweder du stirbst an Lampenfieber oder du wirst es los. Es ist deine Wahl.› Ich habe es gehasst, aber ich habe es geschafft.»
Musik als universelle Sprache
Mittlerweile singt Golda Schultz weltweit auf Konzert- und Opernbühnen und räumt dabei mit vielen Klischees auf. Das fällt nicht immer leicht, wie die Sopranistin in einem Interview klarstellt: «Als Person of Color wird man es in der klassischen Musikszene immer schwer haben. Es wird immer interessant und herausfordernd sein. Viele Menschen gehen davon aus, dass wir keine Verbindung zu klassischer Musik haben, keinen kulturellen oder historischen Kontext, aber das Wesentliche an der Musik ist ja, dass sie eine universelle Sprache ist. Genauso wie Mathematik allgemeingültig ist.» Auch auf die Frage, wie es ist, als Frau in der klassischen Musikwelt zu arbeiten, antwortet sie kritisch. «Frau zu sein in einer männlich dominierten Welt: Das ist kompliziert, manchmal anstrengend, manchmal schön.» Mit ihrem Debütalbum «This be her Verse» unterstrich sie genau diese Aussage musikalisch – mit 18 Liedern von fünf Komponistinnen.
«Mozart, you drive me crazy!»
Golda Schultz liebt Popmusik. Eine ihre Lieblingsbands ist Abba. Als Teenager hörte sie auch gerne die Alben von Christina Aguilera und Britney Spears. Eines ihrer Lieblingslieder von letzterer ist «You drive me crazy». Der Song war es, der den Titel ihres neuen Albums «Mozart, you drive me crazy!» inspirierte. Aber was ist es, was sie an Mozart so verrückt macht? «Wenn man Mozart hört, klingt die Musik immer so einfach. Und erzeugt Ohrwürmer. Doch wenn man die Musik einstudieren muss, merkt man, wie schwierig das ist. Und da kommt die Verrücktheit ins Spiel. Weil ich so gerne die leichte und einfache Seite von Mozart zeigen will, aber mich nicht immer wohl fühle. Du musst ganz genau arbeiten, wenn du die Musik lernst, um dann Freiheit zu bekommen. Diese bildet dann die Chance, den Himmel zu erreichen. Das ist das Besondere bei Mozart: Du fühlst dich wie im Himmel, aber du bist mit den Füssen am Boden. Deshalb macht Mozart mich verrückt. Ich wäre gerne so himmlisch wie er und seine Musik, aber ich bin nur ich.»
Ende als Anfang
In den Konzerten bei uns wird Golda Schultz kein Mozart-Werk singen. Ihr kammermusikalisches Können stellt sie bei einer Aufführung mit den Musiker*innen des Tonhalle-Orchesters Zürich mit einer Palette an Liedern vor, die von der nach wie vor zu entdeckenden Clara Schumann über deren Zeitgenossen Johannes Brahms bis hin zur Musik der Rocklegende Elvis Costello reichen. Ein für die Sopranistin typisches Programm, das ihre stilistische und emotionale Bandbreite demonstriert, mit der sie rund um die Welt das Publikum beeindruckt.
Ihr Debüt beim Tonhalle-Orchester Zürich gibt sie mit den «Vier letzten Liedern» ihres Lieblingskomponisten Richard Strauss. Es ist ein Werk, das sie als «Höhepunkt» ansieht, als «etwas, das man als Sopranistin anstreben sollte» und das sich mit einem weiterentwickelt: «Wenn man einmal angefangen hat, sie zu singen, dann sind das Lieder, die einen lange Zeit begleiten. Die Art und Weise, wie man sie am Anfang singt, wird nicht dieselbe sein wie am Ende.» Ihr Favorit ist das Lied «Beim Schlafengehen »: Es ist vollkommen für sie, «weil ich weiss, dass dies Strauss’ Meditation über ein gut gelebtes Leben ist. Ich weiss, dass er es am Ende seines Lebens geschrieben hat, weil er wusste, dass mehr Dinge hinter ihm als vor ihm lagen. Und das ist in Ordnung. Enden sind ein Teil des Ganzen. Enden sind der Moment vor einem neuen Anfang.»