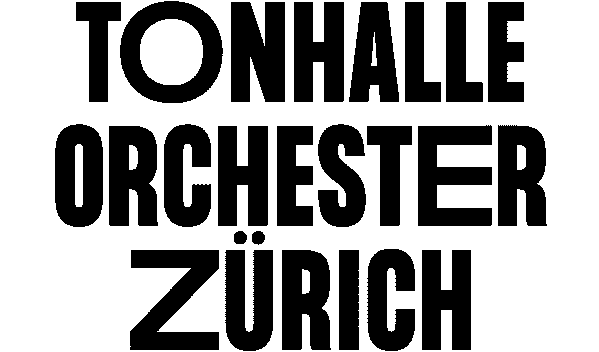Von stachelig keine Spur
Andrea Wennberg sitzt seit 1992 zwischen den Bratschist*innen des Tonhalle-Orchesters Zürich. Weiterziehen will sie nicht, auch in ihrer inzwischen 31. Saison liebt sie ihren Beruf wie ihren Rosengarten. Aber später, doch, später möchte sie weg und ganz neu anfangen.
Vor Konzerten macht es Andrea Wennberg wie die Blumen in ihrem Garten. Sie streckt den Kopf in die Sonne. Das macht sie glücklich. Sie legt sich hin, schläft ein bisschen und tankt Energie. Nach dem Konzert nimmt sie den Zug nach Winterthur und geht wann immer möglich ins Tanzlokal nahe dem Bahnhof: Lindy Hop zu Swing-Musik. Dann schnappt sie das Fahrrad und radelt heim nach Oberwinterthur.
Manchmal übernachtet sie dann draussen, hört und riecht die Natur. Hier, in ihrem Haus, wohnt sie mit der jüngeren ihrer zwei Töchter, die bald 18 wird, die ältere ist 20 und lebt in Berlin. Andrea selbst ist 59, sie hat ihre ersten vier Lebensjahre in Ludwigshafen am Rhein verbracht als zweites von vier Kindern: Sie hat zwei Schwestern, auch sie sind heute Musikerinnen, und einen Bruder, der Maschinenbauer geworden ist – «ausgerechnet der Talentierteste von uns», sagt sie, damals Bratschist wie sie heute, aber mit dem Üben habe er's nicht so gehabt.
Warme Luft und Lebenslust
An diese ersten Jahre erinnert sie sich genau, obwohl sie noch klein war. An den Garten vor dem Haus und den Sandkasten dahinter, und sie erinnert sich an Träume, die sie damals nachts hatte: Immer drehten sie sich ums Verreisen.
Tatsächlich entschieden die Eltern, beide Lehrpersonen, nach Varese in die Lombardei zu ziehen, wo die Familie für neun Jahre lebte. «Dreimal konnte mein Vater seinen Vertrag verlängern. Ich wäre ewig geblieben.» Andreas helle Augen leuchten, wenn sie von diesem Lebensgefühl erzählt: Im Spätsommer noch warme Luft auf der Haut und die Piazza zum Bersten voll von Menschen, Energie und Lebenslust übertragen sich von einem zum nächsten. Es sei schwierig gewesen, mit 13 nach Ludwigshafen zurückzukehren, gerade in der Pubertät, aber nicht im Leben angekommen, wo man doch lieber zu den Leuten mit ihren Vespas gehören wollte als in Deutschland Verstecken zu spielen.
Varese, das war auch die Zeit der ersten musikalischen Schritte. Andreas Vater war selbst ein ambitionierter Geiger, blieb aber Laie, weil seine Eltern ihm kein gutes Instrument hätten kaufen können; das jedenfalls sei seine Überzeugung gewesen. «Vielleicht deswegen hat er uns sehr gefördert», sagt sie, immerhin haben es alle drei Töchter zu seinem eigentlichen Traumberuf gebracht. Daheim gab's Kammermusik, nicht nur der Vater hatte seine Formationen, auch die Kinder spielten im Streichquartett, Andrea damals noch Geige, sie erhielt Unterricht bei einem Lehrer, der in der Mailänder Scala musizierte.
Blutjung unterwegs mit den Stars
«Was für ein grossherziger, wundervoller Mensch», schwärmt sie, zweimal wöchentlich war sie bei ihm, einmal die Woche habe er die Nagelschere rausgeholt und ihre Nägel gestutzt. Andrea lacht. Sie lacht oft. Ihr sonniges, warmes Gemüt verdunkelt sich eigentlich nur, wenn's draussen nass und kalt ist, dann verkriecht sie sich wann immer möglich unter einer Wolldecke und liest einen dicken Roman dieser vielen jungen Autorinnen und Autoren, die sie momentan entdeckt, Belletristik aus Österreich hat es ihr besonders angetan.
Zurück im weniger sonnigen Ludwigshafen aber lief es zumindest musikalisch sehr gut, Andrea war bereits vor dem Abitur Jungstudentin in Mannheim, spielte Wettbewerbe und war Mitglied des Bundesjugendorchesters und des Europäischen Jugendorchesters. In letzterem lernte sie Ute Grewel kennen, ihre langjährige Freundin und bis heute Orchesterkollegin am Kontrabass. Später ist auch Julia Becker, heute Konzertmeisterin im Tonhalle-Orchester Zürich, hinzugekommen. Sie war mit 16 eine der Allerjüngsten. Das Orchester spielte unter Claudio Abbado und Zubin Mehta, ein Niveau, von dem Andrea auch viele Jahre später mit Begeisterung erzählt.
Kein Problem mit Präsentiertellern
Begeistert berichtet sie auch von den Berliner Jahren, von Konzerten unter Herbert von Karajan beispielsweise und von der Chance, den Berliner Philharmonikern jederzeit gratis zuzuhören: Vier Jahre lang studierte sie in Wolfram Christs Klasse, Christ war Stimmführer der Bratschen bei den Berliner Philharmonikern, wo Andrea immer wieder ausgeholfen hat.
Sie zog trotz unvergesslicher Eindrücke weiter, diesmal in die USA, nach Cincinnati, wo sie den Vater ihrer Töchter kennenlernte und ihr Solistinnendiplom abschloss. Eine Saison lang versuchte sie sich an der Oper in Pittsburgh: «Nicht meine Welt», kommentiert sie, weder die Arbeitsbedingungen noch das Repertoire, das sie an sich gerne hat, aber lieber im Publikum als im Graben.
In der Schweiz war eine Tante, die sie dazu ermunterte, beim Tonhalle-Orchester Zürich vorzuspielen. Dieses Vorspielen, dieser Druck: Daran denkt sie nicht gerne zurück. «Es war damals schon schrecklich schwierig», sagt sie, «und heute ist es noch sehr viel schwieriger geworden».
Auf einen Schwumm mit der Posaune
Umso grösser war die Freude, dass es klappte. Andrea brennt für die grosse, symphonische Literatur, sie liebt es, mitten auf der Bühne zu sitzen. «Klar, es ist wahnsinnig intensiv, dieses Leben auf dem Präsentierteller, aber es ist alles, was ich will.» Noch heute ist sie begeistert von ihrer Arbeit und setzt alles daran, mit Energie und Disziplin zur Leistung ihres Orchesters beizutragen.
Es habe sich viel verändert, seit sie vor 31 Jahren in Zürich angefangen habe. Das Niveau sei noch höher heute, die Disziplin sei enorm, aber auch die Komplexität der Institution sei mitgewachsen: Die Aufnahmeprojekte, nicht mehr wie früher in einer Studiosituation sondern live, die Streamings, die Internationalität.
Klar, sind in allen diesen Jahren auch enge Beziehungen entstanden innerhalb des Orchesters. Andrea treibt zum Beispiel Sport mit den Kolleginnen und Kollegen, mit dem Posaunisten in der Mittagspause kurz Winterschwimmen, mit dem Hornisten joggen auf Konzertreise. Nein, sie will nirgendwo sonst sein in ihrem Leben, auch wenn es kurz vor ihrem Studium und dann nochmals mitten im Berufsleben Momente gab, in denen Andrea mit der Medizin und der Pflege geliebäugelt hat.
Garten als Insel
Schon als Mädchen mochte sie es, die Grosseltern zu verarzten, liess sich Bücher schenken, die sie verschlang und lernte als Mutter, Homöopathie anzuwenden. «Heute bin ich dankbarer denn je, in diesem wunderbaren Orchester zu spielen.»
Wenn es dann aber so weit ist, wenn Andrea pensioniert sein wird, dann will sie neu anfangen. Dann will sie sich ein Häuschen kaufen am Meer, auf irgendeiner Insel dieser Welt. Vielleicht auf den Kanaren, vielleicht in Madeira.
Bis es so weit ist, pflegt sie die geliebten Rosen in ihrem Garten und nimmt die Kratzer der Dornen in Kauf, erntet Mirabellen und Pflaumen. Wenn es zu kalt wird, steigt sie ins Flugzeug und verreist: Der Sonne entgegen.