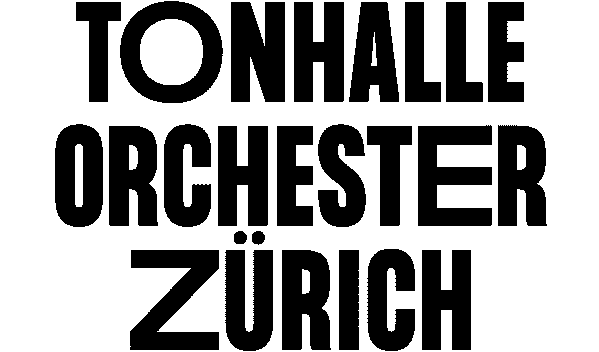Die Biotech-Guarneri
In den Laboren der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa in St. Gallen und Dübendorf haben Holzforscher und Akustiker Biotech-Violinen nach dem Vorbild einer Meistergeige aus dem 18. Jahrhundert geschaffen.
Es jagt einem erst einmal einen kleinen Schauer über den Rücken: Pilzbefall. Doch anders als auf alten, wertvollen Schriftquellen wie Büchern kann der Befund bei Geigenholz durchaus positiv sein – vor allem, wenn er absichtlich herbeigeführt wurde. Es ist ein bisschen wie mit einem feinen Käse: Pilze können nicht nur schädigen, sondern auch veredeln.
Holzveredelung mit Pilzen
So konnten vor einigen Jahren Holzforscher der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt, der Empa, eine kleine Sensation präsentieren: Mithilfe eines Pilzes war es gelungen, moderne Hölzer zu veredeln. Ihre Eigenschaften wurden so verändert, dass sie unter dem Mikroskop den alten Hölzern von Meistergeigen wie einer Stradivari oder einer Guarneri in nichts nachstanden.
«Heutzutage wachsen Bäume schneller und ungleichmässiger als zu einer ganz bestimmten kühlen Periode im 17. Jahrhundert, als das Holz für Stradivaris Instrumente wuchs», so Francis Schwarze von der Empa-Abteilung Cellulose & Wood Materials. Um moderne Hölzer von Fichte und Ahorn zu verändern, nutzte er einen Pilz, der in der Natur die sogenannte Weissfäule verursacht. «Sobald die Holzstruktur den gewünschten Zustand erreicht hatte, wurden die Pilze durch ein keimtötendes Gas entfernt», sagt Schwarze. Aus diesem Pilzholz wurden dann von den erfahrenen Geigenbauern Michael Baumgartner und Paul Beley einige Musterviolinen gefertigt. Vorbild war die «Caspar Hauser» aus dem Jahr 1724 – ein Instrument des legendären Geigenbaumeisters aus Cremona, Giuseppe Guarneri, auch bekannt als Guarneri del Gesù. Die wissenschaftlichen Untersuchungen gingen in eine neue Runde.
Im Klanglabor
Am Empa-Standort in Dübendorf haben die Akustiker der Abteilung Acoustics/Noise Control die Instrumente in ihrem Klanglabor untersucht. Hier herrschen ideale Voraussetzungen:
Die Wände, die Decke und der Boden reflektieren den Schall in einem gewissen Frequenzband nicht. Armin Zemp, der 2018 die Testreihe geleitet hat, erklärt die Bedeutung eines solchen Raums: «Wenn wir hier drinnen Untersuchungen machen, haben wir Bedingungen, als ob wir im freien Feld wären. Das heisst, alles, was wir messen, ist nicht beeinflusst durch irgendwelche Reflexionen von den Wänden, die dann den Schall auf das zu untersuchende Objekt zurückwerfen. Wir können jegliche Einflüsse der Umgebung eigentlich ausschliessen. Deshalb ist dieser Raum ideal geeignet, um wirklich nur die Geigen auf ihre akustischen Eigenschaften zu untersuchen.»
Doch nicht nur eine störungsfreie Umgebung ist für saubere Messergebnisse nötig. Wichtig war den Forschern auch die Auswahl der Instrumente: In einer Mess-Serie haben sie ein Set von sieben unterschiedlichen Geigen untersucht. Sechs waren aus dem gleichen Baum und Segment aus unbehandeltem oder pilzbehandeltem Klangholz gefertigt worden, als exakte geometrische Kopien der «Caspar Hauser». Dabei war auch eine echte Meistergeige aus dem 18. Jahrhundert. «Es gibt auch eine moderne Nicht-Meistergeige in der Untersuchungsreihe, um die obere und untere Referenz zu haben. So können wir Aussagen darüber treffen, wie relevant allfällige Unterschiede zwischen behandelter und unbehandelter Geige dann zu interpretieren sind.»
Künstlicher Violinist und Vibrometer
Analysiert werden aber ausschliesslich die Messergebnisse. Damit nicht die Interpretationskünste von einem oder gar mehreren Musiker*innen bewertet werden, kommt im Klanglabor zunächst ein besonderer Geigenspieler zum Einsatz. Armin Zemp stellt ihn vor: «In dieser Box haben wir ein Instrument, das wir Shaker nennen. Damit kann man die Saite der Geige anregen – dort, wo eigentlich der Bogen darüberstreicht. Wir können einen Bogenstrich imitieren, ohne dass wir auf einen Musiker angewiesen sind, der für uns über mehrere Stunden konstant eine Saite streicht. Das ist also unser künstlicher Geigenspieler.»
Dieser elektromechanische Schwingungserreger ist über den Computer mit den Messgeräten verbunden. Er lässt nacheinander sieben Instrumente im Blindtest gegeneinander antreten. Die Akustiker wissen nicht, was für eine Geige sie gerade vor sich haben.
Bei der sogenannten Körperschallmessung sollen allein die Messdaten entscheiden, ob die Violinen aus Pilzholz tatsächlich klanglich mit den alten Meistergeigen mithalten können. Die Akustiker versuchen, Unterschiede auszumachen, wie sich der eingeleitete Schall im Instrument ausbreitet, und auch, ob die Geigen unterschiedlich Schall abstrahlen. Dafür wird das Schallfeld, das die Violine abgibt, mit zehn Mikrofonen vermessen. Zugleich werden die Schallwellen im Geigenkörper mittels Scanning Laser Vibrometer aufgezeichnet. Dieses Gerät misst an rund 100 Stellen auf dem Geigenkörper die Frequenz und die Amplitude der Schwingungen.
Die ungeheure Menge an Messergebnissen wertet der Akustikforscher Bart Van Damme aus. Er erklärt, wie eventuelle Unterschiede der Schallabstrahlung bei den alten und modernen Geigen zustande kommen: «Das Holz der Geigen aus dem 18. Jahrhundert ist ein bisschen schwerer und steifer. Denn im damals kälteren Klima ist es langsamer gewachsen. Es ist nicht nur die Steifigkeit allein, die wichtig ist, und auch nicht nur die Dichte. Es ist wirklich die Kombination aus beidem. Und diesen Zusammenhang kann man, gemäss Messungen, mit dieser Pilzbehandlung erreichen. Pilzbehandeltes Holz wird bei anderen Frequenzen schwingen als das gleiche Holz, baulich in der identischen Form, das aber nicht pilzbehandelt ist. Diese Unterschiede in Dichte und Steifigkeit haben dann auch einen Effekt auf die Schallabstrahlung.»
Sichtbar gemacht werden diese Unterschiede am Computer anhand der Messwerte: Zu sehen sind Bilder von Geigenkörpern in Regenbogenfarben, wie man sie von einer Wärmebildkamera kennt. Dazu erscheinen verschiedenste Schallkurven.
Vom Schall zum Klang
Die Schallanregung ist aber noch nicht das, was wir als Ton wahrnehmen, macht Bart Van Damme deutlich: «Für uns Akustiker geht es erst einmal um ein Mindestmass an Energie, um eine bequeme Messung zu machen – und noch nicht um Klang. Hier ist das Verhältnis zwischen Saitenschwingung, Körperschwingung und Schall entscheidend, das von den Mikrofonen gemessen wird. Für Reto ist wirklich der Klang wichtig, möglichst nah zu realistischen Tönen zu kommen. Tönt es, wie eine Geige tönen soll?»
Reto Pieren ist Psychoakustiker bei der Empa. In einem Labor für Hörversuche hat er weitere Forschungen betreut, die nach den Schallmessungen der Geigen in einem nächsten Schritt folgten: «Bei psychoakustischen Untersuchungen gibt es Probanden, also Leute, die sich Geräusche bis hin zu Musik, die mit den Probeinstrumenten eingespielt wurde, anhören. Diese Personen beurteilen das Gehörte einzeln. Das heisst, sie sitzen nicht zusammen und besprechen das, sondern jede Person beurteilt separat.»
Mithilfe einer computergestützten, zufallsgesteuerten Fragenauswahl versuchen die Psychoakustiker die Klangeigenschaften der einzelnen Geigen und ihre Wahrnehmung durch den Menschen zu ergründen – möglichst ohne persönliche Interaktion zwischen Versuchspersonen und Forschern. Dafür gibt es unterschiedliche Verfahren und Fragestellungen: «Gefällt Ihnen das Instrument a besser als b? Oder: Wie gefällt Ihnen dieses Instrument auf einer Skala zwischen 0 bis 10? Ziel ist es, am Ende ein Ergebnis zu erreichen, das konsistent ist. Unsere Hörversuche haben tendenziell zwischen 20 und 100 Probanden. Wenn zwei Instrumente sich radikal unterscheiden, dann braucht man nicht sehr viele Testpersonen, um Differenzen messen zu können. Wenn es kleinere Unterschiede sind, benötigt man entsprechend mehr Probanden.»
Für ein möglichst allgemeingültiges Ergebnis bei den psychoakustischen Untersuchungen braucht es bei der Gruppe der Test-Hörer*innen eine gute Durchmischung, von Laien bis hin zu Profis. Dazu zählen Tonmeister*innen, die sich von Berufs wegen den ganzen Tag mit dem Klang von Instrumenten oder speziell Geigen befassen. Sie hat Daniel Dettwiler vom Studio Idee und Klang als Expertengruppe für gezielte Hörversuche und vertiefte Befragungen zusammengebracht. Menschliche Ohren und hochpräzise Messgeräte kamen also gleichermassen zum Einsatz auf dem Weg zur Biotech-Geige aus Pilzholz, die mehr ist als ein Werbegag. Das Ergebnis ist keine blosse Bekundung von euphorischen Bastlern, sondern basiert auf durchaus profunden Erkenntnissen aus drei Bereichen: der Holzforschung, der Schallmessung und der Psychoakustik.
Die «Caspar Hauser II»
Die Zeit war reif für den nächsten Schritt: Nach Jahren der Entwicklung eines neuen Verfahrens zur Holzbehandlung, nach neun Monaten in einer Pilzlösung, nach der Fertigung durch zwei erfahrene Geigenbauer sowie nach schalltechnischen und psychoakustischen Tests im Wettstreit mit anderen Instrumenten und dem Publikum wurde die «Caspar Hauser II» der Öffentlichkeit präsentiert. Unsere Geigerin Irina Pak durfte das Instrument als erste Profigeigerin testen. Ermöglicht hat das Projekt Walter Fischli, dem vor allem am Herzen liegt, dass die Violine nun gespielt wird: «Die ‹Caspar Hauser II› ist unsere erste Pilzgeige, gefertigt aus noch nicht optimalem Tonholz, und noch ein Greenhorn. Inzwischen gibt es weitere Caspar Hauser-Serien III und IV und Pilzholz- Bratschen. Für alle gilt, dass das Einspielen von Holzinstrumenten seine Zeit braucht. Dabei wird sich zeigen, ob sie sich – zusammen mit weiteren Mycowood-Geigen – auch künftig positiv entwickelt.» Die Idee des Mäzens, der selbst promovierter Biochemiker ist, wäre eine konsequente Nachwuchsförderung: «Letztlich sollen Instrumente entstehen, die talentierten jungen Musikerinnen und Musikern mit knappen finanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden können.»
Der Grundstein dafür ist gelegt. Dank des interdisziplinären Projekts sind die akustischen Eigenschaften von Klangholz verbessert worden, das heisst unter standardisierten Bedingungen reproduzierbar. «Mit dieser Art der Biotech-Holzmodifikation könnten zudem Lieferengpässe bei wertvollen Klanghölzern vermieden werden», so Holzforscher Francis Schwarze. Ziel sei es, gutes Ausgangsmaterial in ausserordentliches Klangholz zu verwandeln und so den traditionellen Musikinstrumentenbau in Europa zu fördern. Das sind doch ganz gute Aussichten für die Meistergeigen des 21. Jahrhunderts.