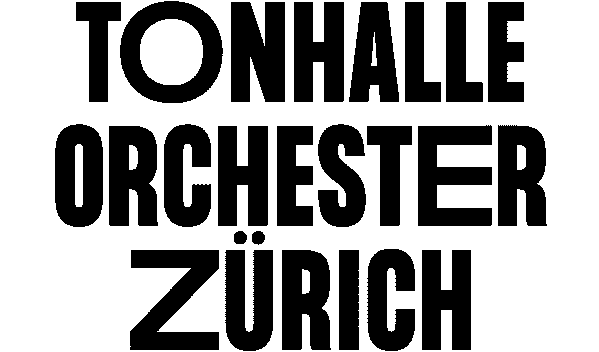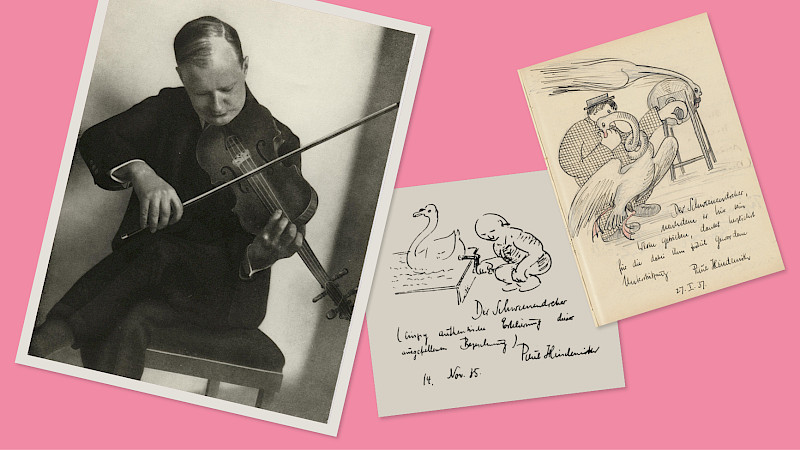«Musik machen geht besser, wenn man sich öffnen kann»
Wie ist es, als Geschwister zusammenzuspielen? Tanja und Christian Tetzlaff erzählen es im Doppelinterview – bevor sie in der Tonhalle Zürich Brahms’ Doppelkonzert aufführen.
Worüber würden Sie reden, wenn ich nicht hier wäre? Über Musik oder über etwas anderes?
Tanja Tetzlaff Auf jeden Fall über etwas anderes. Wir haben uns jetzt relativ lange nicht gesprochen und es brennen viele Themen.
Christian Tetzlaff Familiensachen, Krankheitssachen, Kinder …
TT Wenn wir gerade zusammen proben, reden wir natürlich auch über Musik. Und manchmal überschneidet sich das. Es kommt immer wieder vor, dass man über die Stücke, die man miteinander erarbeitet und erlebt, auf Gefühle kommt, die einen ins Persönliche hineinleiten. Es ist oft kein Entweder-oder, weil Musik nun mal einen grossen Teil unseres Privatlebens erfüllt.
CT Oder andersherum – unser Privatleben erfüllt unsere Musik. Das merkt man in den Proben: Je nachdem, wie jemand drauf ist, gibt das ganz unterschiedliche Impulse.
Gibt es einen Unterschied, ob Sie zusammen musizieren oder mit anderen, die nicht zur Familie gehören?
CT Das ist natürlich nicht das Gleiche. Unsere engsten Kammermusik-Buddies kommen allerdings sehr nahe an die Familie heran. Wir spielen schon lange mit ihnen, wir reden über alles.
TT Wir sind in einem Alter, in dem wir uns gerne Projekte mit Leuten aussuchen, mit denen es sich fast so anfühlt wie mit Geschwistern. Musik machen geht einfach besser, wenn man sich öffnen kann. Und das ist leichter mit Menschen, bei denen man weiss, das wird nicht ausgenutzt, da kommen keine fiesen Spitzen, sondern Freundschaft und Liebe. Es hilft, einen geschützten Raum zu haben, in dem man dann musikalisch in die Extreme gehen kann.
CT Ich könnte mir vorstellen, dass es bei manchen Geschwistern umgekehrt ist, dass da Konflikte mit musikalischen Mitteln ausgetragen werden. Aber dieses Gefühl habe ich bei uns nicht.
Es gibt Geschwister-Duos, die ausschliesslich zusammen auftreten. Sie spielen zwar seit 1994 gemeinsam in einem Quartett, sie hatten auch zahlreiche Trio-Auftritte mit dem früh verstorbenen Pianisten Lars Vogt. Aber gleichzeitig verfolgen Sie unabhängige Karrieren.
TT Es hat unglaublich viele Vorteile, wenn man sich nur ab und zu begegnet. Einerseits bringt man aus all den eigenen Projekten vieles in die Zusammenarbeit mit. Und andererseits rein menschlich: So lieb ich Christian habe, ich weiss nicht, ob ich das ganze Jahr mit ihm verbringen wollen würde. Das ist mit niemandem leicht. Auch mit meinem Mann, mit dem ich viel Musik mache, würde ich nicht ausschliesslich spielen wollen. Es ist so intensiv, man braucht zwischendurch Zeiten, in denen man mit anderen Leuten unterwegs ist.
CT Das sehe ich genauso. Was haben wir für Wandlungen durchgemacht im Quartett, weil der eine mit dieser Kollegin zusammengespielt und die andere bei jenem Dirigenten etwas aufgesogen hat! Es ist schön, nicht nur im eigenen Saft zu schmoren.
TT Dazu kommt das Repertoire. Ich mache ganz unterschiedliche Dinge, längst nicht bei allen kommt eine Geige vor. Und auch das Unterrichten hat inzwischen einen grossen Stellenwert bei mir.
Wie hat das Ganze denn angefangen bei Ihnen? Sie kommen nicht aus einer Musikerfamilie, sondern aus einer Pastorenfamilie.
TT Es war schon fast eine Musikerfamilie. Unsere Eltern haben immer gesungen, auch Instrumente gespielt. Und zumindest unser Vater wäre wohl tief in seinem Herzen gerne Musiker geworden. Musik war ein selbstverständlicher Bestandteil unserer Kindheit, aber nicht auf eine bedrückende Art. Wenn man mit Musikereltern aufwächst, kann es ja auch sein, dass man den Stress mitbekommt oder den ewigen Trott; dass die Musik dann eine negative Farbe erhält für die Kinder.
CT Für unsere Eltern war es klar, dass wir Musik machen. Es wurde nie nach Alternativen gefragt. Andere hören ja, dass sie erst etwas Anständiges lernen sollen. Wir mussten nichts Anständiges lernen.
TT Das hat wohl mit dem Pastoren-Hintergrund zu tun, das ist schon ein bildungsbürgerliches Umfeld – um diesen etwas angestrengten Begriff zu verwenden. Wir wurden musikalisch gefördert, aber sportlich zum Beispiel gar nicht. Bei meinen eigenen Kindern merke ich jetzt, dass Sport absolut eine Alternative ist, etwas Tolles, in das man sich voll reingeben kann.
CT Bereits Luther hat gesagt, eine andächtige Musik könne viel mehr Menschen bewegen als Worte, Bach sah das genauso. Das waren Grössen, die in unserem Elternhaus durchaus präsent waren. Und ich nehme das ganz ohne religiösen Hintergrund mit Freuden mit ins Musizieren: dass das ein Seelendienst ist und von daher gar nicht so anders als das, was mein Vater gemacht hat. Nur halt ein bisschen weiter gefasst. Unsere Eltern haben das Musizieren wohl auch deswegen gern gesehen, weil man sich dabei ebenfalls mit wesentlichen Dingen auseinandersetzt.
TT Gottesdienste und Konzerte haben schon einiges gemeinsam. In der Kirche wie im Konzertsaal gibt es diese Stille, die Konzentration von vielen Menschen auf ein gemeinsames Gefühl, auf etwas, das im Moment stattfindet.
Sie erzählen hier zu zweit, aber Sie sind insgesamt vier Geschwister, die alle professionell Musik machen. Oft ergeben Geschwister-Konstellationen perfekte Besetzungen – ein Streichquartett, ein Klaviertrio. Bei Ihnen ist das anders: Ihre Schwester Angela Firkins ist Flötistin, Ihr Bruder Stephan Tetzlaff hat mit Trompete begonnen und ist heute Dirigent.
CT Es gab immerhin ein Stück für uns, nämlich die Triosonate aus dem «Musikalischen Opfer» von Bach. Die konnten wir spielen, weil unser Bruder auch ein guter Pianist ist.
TT Wir haben alle viel in Gottesdiensten musiziert, in unterschiedlichen Kombinationen. Unser Bruder hat an Weihnachten jeweils vom Turm geblasen, das war extrem stimmungsvoll. Aber es gab tatsächlich nie den Plan, aus uns Kindern eine Kammermusikgruppe zu machen. Da war ja auch der Altersunterschied: Christian war schon als Musiker unterwegs, als ich fast noch mit Playmobil spielte.
Der Unterschied zwischen Ihnen beträgt sieben Jahre. Ab welchem Alter begegneten Sie sich auf derselben Ebene?
TT Ich habe immer aufgeblickt zu Christian, bis ins Studium hinein. Das Gefühl, dass wir jetzt zusammenspielen können, weil das Gefälle nicht mehr da ist, das kam erst in meinen Zwanzigern. Damals hatte ich mir schon viel Eigenes aufgebaut, ich wusste, ich bin eine selbstständige musikalische Persönlichkeit. Ab dann ging es sehr gut.
CT Es war auch ideal, dass wir dann im Quartett spielten, da gibt es so viele Dynamiken mit unterschiedlichen Beziehungen. Das war sicher der beste Weg, um so intensiv zusammenzuspielen, wie wir es gemacht haben.
TT Wir sind ein sehr demokratisch agierendes Quartett. Es gibt ja durchaus Ensembles, in denen der erste Geiger sagt, jetzt machen wir das so und so.
CT Dieser Traum von mir ist nie in Erfüllung gegangen …
TT Das kann ja noch kommen!
CT Lieber nicht. Es ist schön zu sehen, dass es im Musikbetrieb nicht mehr so viele Diktatoren gibt wie früher.
TT Darum freuen wir uns übrigens auch so sehr auf die Zusammenarbeit mit Paavo Järvi: Er ist das Paradebeispiel für jemanden, der ein unglaubliches Können hat, aber nie als Herrscher auftritt. Ich habe in meiner Zeit in der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen sehr viel unter seiner Leitung gespielt. Später habe ich als Solistin mit ihm gearbeitet, und ich fand es wunderschön, dass das ging. Es kann ja sein, dass man dann in dem Verhältnis Dirigent-Orchestermusikerin verharrt. Doch sobald ich vorne sass, war ich wirklich eine gleichwertige Kollegin. Es geht bei ihm nie um hierarchische Strukturen, das hilft der Musik.
CT Gerade beim Doppelkonzert von Brahms, das wir nun in Zürich spielen. Das ist ein Stück, in dem gleich vier Akteure ihren Brei kochen wollen: der Dirigent, zwei Solisten und das Orchester. Wenn es da zum Wettstreit zwischen den Solisten kommt, wenn der Dirigent etwas möchte und die anderen sich dagegenstellen, geht so ein Werk überhaupt nicht. Hier sind wir sicher, dass wir zu einer tiefen Zusammenarbeit kommen.
Sie spielen in diesem Werk eigentlich ein einziges grosses Instrument, die Partien der Violine und des Cellos gehen oft nahtlos ineinander über. Was bedeutet das für die Solisten?
CT Man muss Freude daran haben, den anderen zu unterstützen.
TT Das Stück funktioniert nicht mit zwei Solisten, von denen jeder versucht, lauter und schneller und eindrucksvoller zu sein. Man muss sich die Linien zuspielen, damit das Ganze einen Sinn hat. Und wenn einer die Melodie hat und der andere die Begleitung, dann muss sich diese Begleitung zurücknehmen – selbst wenn man in dem Moment weiss, dass nicht alle Töne gehört werden.
CT Das Werk ist eine Art Versöhnungsangebot an den Geiger Joseph Joachim. Brahms hatte sich im Ehestreit der Joachims auf die Seite der Frau gestellt, danach haben sich die beiden jahrelang gemieden.
TT Am Anfang steht ein Cellomotiv, das fast wie eine Anklage wirkt: Wie konntest du nur! Oder: Wie konnte es nur so weit kommen! Im Laufe des Stücks finden die Instrumente zusammen, die Musik wird immer versöhnlicher.
Wie oft haben Sie das Werk schon miteinander gespielt?
TT Unzählige Male!
CT Vielleicht vierzig?
TT Das erste Mal war aufregend, ich hatte das Stück eben erst im Studium gelernt und musste für Alban Gerhardt einspringen. Da war ich schon froh, dass Christian mein Gegenüber war. So war die Atmosphäre trotz allem relativ entspannt.
Haben Sie eigentlich den gleichen Musikgeschmack?
TT Ich liebe Prokofjew, Christian mag ihn eher nicht. Und ich bin wohl weniger kritisch gegenüber zeitgenössischen Werken, die sehr melodiös oder esoterisch angehaucht sind. Christian hätte das zumindest früher als seicht bezeichnet, heute vielleicht weniger – oder nicht?
CT Wer weiss. Man muss das von Fall zu Fall beurteilen.
TT Aber was wir sonst hören, ist gar nicht so unterschiedlich. Wir mögen beide so altmodische Bands wie Cream, die Beatles oder Radiohead. Und wir sind begeistert, dass unsere Kinder sie ebenfalls mögen.
CT Bei mir ist durch meine Frau auch noch die italienische Musik dazugekommen: Lucio Dalla, Lucio Battisti, diese ganze Cantautori-Tradition, die ich früher nicht kannte. Das ist eine Kultur, die es in Deutschland nicht gibt – mit Schlagern und Popsongs, die sehr beeindruckend und schön sind.
Wurde in Ihrem Elternhaus denn auch Pop gehört?
CT Nein, da waren wir ausschliesslich klassisch ausgerichtet.
TT Das werfe ich meinen Eltern fast ein bisschen vor, dass dieser riesige Teil der Musikwelt verpönt war und nur unsere Nische bewacht wurde. Ich finde es so herrlich, was meine Kinder hören – und wie mein ältester Sohn nicht nur Fagott studiert, sondern auch Beats bastelt. Da sehe ich immer, wie verblendet wir waren.
CT Vor allem, weil es mit Unkenntnis verbunden war, nach dem Motto: Wir hören es nicht, aber wir finden es trotzdem schlecht.
Zum Schluss noch eine hypothetische Frage: Wären Sie ein anderer Musiker, eine andere Musikerin geworden, wenn Sie nicht in der Familie musiziert hätten?
CT Ganz egal, ob es in der Familie passiert oder im Jugendorchester: Es ist ein riesiger Unterschied, ob man als Kind das Zusammenspiel erlebt oder immer nur alleine übt. Ich wollte nur deshalb Musiker werden, weil ich es liebte, im Orchester die Sinfonien von Brahms oder Tschaikowsky zu spielen. Gerade bei der Geige gibt es viele, die entsetzlich viel üben, die von den Eltern und Lehrpersonen auch dazu angehalten werden; Ensemblespiel gilt da als geradezu schädlich. Aber ich bin überzeugt: Auf lange Sicht haben jene, die Musik als soziale Tätigkeit begreifen, mehr Vergnügen daran.
TT Ich hätte dieselbe Antwort gegeben. Ich bin oft schockiert, wenn ich an der Musikhochschule höre: Ach, jetzt müssen wir wieder ins Orchester, dabei sollten wir doch üben.
CT Man kann nicht immer allein üben und dann irgendwann sagen: So, jetzt habe ich alles gelernt, jetzt spiele ich Streichquartett. Die anderen mitzudenken und sich einzuhören, das lernt man nur, wenn man richtig musiziert – also mit anderen zusammen. Wenn ich heute als Solist mit einem Orchester auftrete, weiss ich ganz genau, wie lange eine Bläsergruppe braucht, um einen Akkord zu spielen, ich kann das alles antizipieren.
TT Es ist auch eine ganz andere soziale Haltung. In der Kammermusikgruppe oder im Orchester geht es nicht darum, der oder die Beste zu sein, sondern gemeinsam etwas zu schaffen.
CT Da sind wir wieder bei der Verflechtung von Musizieren und Leben, über die wir am Anfang gesprochen haben. Im Ensemble lernt man, dass man kritisiert werden kann und trotzdem Freunde bleibt. Man gewöhnt sich daran, zuzuhören und sich gegenseitig zu unterstützen, aber auch zu sagen: Guck mal, das ist nicht ausdrucksvoll genug. Diese Erfahrung hilft einem fürs gesamte Leben.