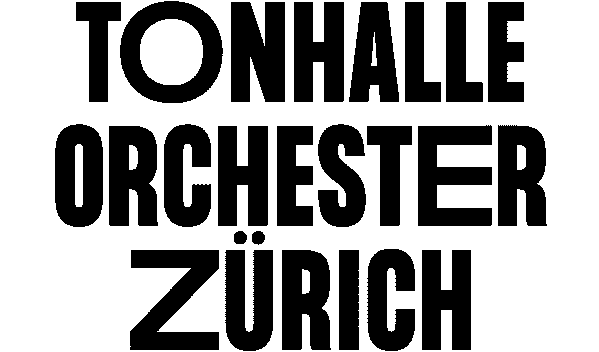«Ich werde davon nie müde»
Maestro Herbert Blomstedt wird im Juli 97Jahre alt – und sprüht vor künstlerischer Energie. Im Frühjahr 2022 sprach er im Interview in seiner Luzerner Wohnung über trotzige Neugierde, seine grosse Privatbibliothek und Souvenirs seines erfüllten Dirigentenlebens.
Herr Blomstedt, wir durften im Juni 2021 eine beeindruckende Fünfte von Bruckner mit Ihnen erleben. Sie verfolgen musikwissenschaftliche Neuausgaben und beginnen lange vor einer Aufführung mit dem Notenstudium der Werke, die Sie dirigieren. Was beeinflusst ausserdem Ihren Blick auf diese Meisterwerke?
Die Perspektive ändert sich ja stets. Von Tag zu Tag eigentlich, auch wenn das unbewusst ist. Man merkt das vielleicht erst später. Auch Bruckners Schüler waren sehr begeistert und haben es sicherlich nur gut mit ihm gemeint, wenn sie seine Werke stark bearbeitet haben. Ich glaube nicht, dass Bruckner das so gewollt hätte. Er hat den Ausdruck immer eingebaut in seine Werke, in der inneren Konstruktion des Werks. Man braucht da keine äusserlichen Mittel wie zehn Extra-Trompeten. Das ist eigentlich ein Zeichen der Schwäche, wenn man da von innen her nicht die richtige Balance herstellen kann – sondern nur von aussen. Vielleicht beeindruckt das kurzzeitig das Publikum oder es steht in den Zeitungen, und man glaubt, es sei wichtig, aber es ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, genau zu studieren, wie diese Werke gearbeitet sind. Wenn man diesen Ideen nachgeht, merkt man, wie seine Fantasie arbeitet. Es entsteht immer Neues aus dem Studieren des Alten. Und das ist sehr beeindruckend. Deswegen klingen diese Werke auch so komplett. Das ist keine Reihe von schönen Einfällen. Zwischen diesen schönen Einfällen, die vielleicht einmal im Jahr kommen, liegt viel Arbeit. Das ist bei Bruckner so, aber auch bei Beethoven und Brahms. Schöne Einfälle gibt es, aber so sind die Werke nicht entstanden. Das ist die Arbeit von einem Komponisten – und dadurch werden die Werke auch einheitlich und gross, so reich und bedeutungsvoll, dass man nie müde wird, das zu studieren. Man entdeckt immer neue Sachen.
Das klingt nach Ihrer Idee, warum Sie Ihre eigenen Interpretationen immer wieder hinterfragen?
So wie ich das verstehe, geht es darum, etwas zur Debatte zu stellen, auch ein bisschen zu zweifeln. Das ist ja schön, aber ...! In dieser Weise arbeitet der Komponist weniger. Er entdeckt selbst neue Sachen. Er ist nie zufrieden. Nicht, dass er sagt: Nein, das war falsch. Darum geht es nicht. Es geht nicht um neue Wahrheiten, sondern um neue Varianten, neue Zusammenhänge. Das macht das Leben der Komponisten so interessant. Und für den Interpreten, der die Zeit und den Willen hat, dem nachzugehen, ist das ungeheuer spannend. Ich werde davon nie müde! Ich bin wie ein neugieriges Kind. Haben Sie Kinder? Sie wissen ja, mit drei, vier oder fünf Jahren fragen sie ununterbrochen. Sie wollen alles wissen. Das ist manchmal sehr ermüdend für die Eltern – man ist dankbar dafür, aber verliert auch mal die Geduld. Aber nein, man muss immer neugierig sein. Bei jedem Künstler, jeder Künstlerin, der/die keine Probleme hat und alles gut findet, ist es fraglich, ob er/sie überhaupt ein*e Künstler*in ist. Wenn es zu leicht kommt, dann wird man eingebildet. Dann sucht man nicht mehr, und dann ist es zu Ende.
Diese Neugierde erkennt man auch in Ihren Programmen mit dem Tonhalle-Orchester Zürich, mit dem Sie seit vierzig Jahren verbunden sind. Bei Ihrem Zürcher Debüt im März 1982 dirigierten Sie ein reines Beethoven-Programm, kurz darauf schon ein Werk von John Adams. Im Dezember 2022 werden Sie die Sinfonie Nr. 2 von Franz Berwald leiten. Wählen Sie heute Ihre Programme anders aus als in früheren Tagen?
Ja und nein. Wenn man Chef von einem Orchester ist, hat man auch eine besondere Verantwortung. Man muss das Repertoire planen, damit sich das Alte nicht immer wiederholt. Und wenn man Neuigkeiten wählt, muss man beachten, dass es nicht nur um die Neuigkeit geht, sondern auch Qualität bringt. Ausserdem ist man ein Repräsentant für das lokale Musikleben. Und das Publikum soll sich auch entwickeln können. Als Chef hat man viele Aufgaben. Wenn man hingegen als Gast nur ein Konzert macht, hat man ganz andere Möglichkeiten und weniger Zwänge. Man kann den eigenen Wünschen etwas mehr nachgehen. Und manchmal tut es mir leid, dass das Publikum das noch nicht kennt, was ich entdeckt habe. Das möchte man weitergeben. Es steckt also ein bisschen Missionar in jeder/m Musiker*in.
Welche Rolle spielt das Publikum bei Ihrer Auswahl?
Das Publikum ist in jeder Stadt ein bisschen anders, und das ist gut so. Auch wenn man älter wird, darf man nicht einfach nur auf ein paar wenige Schlachtrösser zurückgreifen, nur weil man glaubt, man hat damit mehr Erfolg. Das ist primitiv, eigentlich abscheulich. Dieser Gesichtspunkt «Habe ich damit Erfolg?» ist mir nie eingefallen. Ich bin überzeugt von einem Stück, und das Publikum soll das dann entdecken. Aber dem Publikumsgeschmack nachzugeben, das habe ich nie gemacht. Das hängt vielleicht mit meiner Erziehung zusammen. Das Populäre war mir immer verdächtig. Das Eingängigste, was am leichtesten zu verdauen ist, bei dem man sich nicht anstrengen muss, ist nie das Beste.
Was war darüber hinaus prägend bei der Auswahl Ihres Repertoires?
In Göteborg, in meinen Studentenjahren, gab es ein blühendes Musikleben. Die Handelsleute haben es mit ihrem Geld finanziert. In Stockholm gab es noch kein Sinfonieorchester, in Göteborg aber schon. Hier hat man, unabhängig vom Königshaus, experimentiert und nach dem Besten gesucht. Das ist ein ähnliches Verhältnis wie zwischen Dresden und Leipzig in Sachsen. In Dresden war es der König, der früh wunderbare Sachen ermöglicht hat. Leipzig zog 200 Jahre später nach, dann kamen die reichen Bürger*innen: Wir müssen uns nicht an den königlichen Geschmack halten, wir machen, was wir denken. Das ergibt viele interessante Spannungen. Und ich suche auch immer das Beste. Die Leute mögen sagen, ich sei ein Snob. Aber ich folge einem guten Rat, das hat Goethe schon gesagt: Suche dir die besten Kameraden! Du musst nur mit Leuten gehen, die besser sind als du. Ein kluger Rat!
Anlässlich Ihres 85. Geburtstages hatten Sie die «Mission Stenhammar» zur Wiederentdeckung der Werke von Wilhelm Stenhammar ausgerufen. Wie ist denn der aktuelle Stand dieser Mission?
Es steckt in dieser Haltung natürlich ein bisschen Trotz. Aber Trotz ist gut! Vor allem für Künstler*innen ist er gut. Es soll kein Schaden für andere Menschen entstehen. Aber er ist eine grosse Treibkraft, etwas Gutes zu machen. Ein Beispiel dafür ist Stenhammar, der in Göteborg tätig war – auch in Stockholm, wo er geboren wurde. Aber in Göteborg liegt er begraben, das war die Endstation seiner Tätigkeit. Er war ein grosser Vorkämpfer für andere Komponisten. Nicht für sich selbst! Sein Vertrag besagte, dass er jede Saison ein Werk von sich selbst spielen darf. Die ersten fünf Jahre hat er überhaupt keines von sich selbst aufgeführt. Dabei war er ein grossartiger Komponist. Stattdessen hat er sich für andere eingesetzt, völlig selbstlos. Auch für Carl Nielsen und für Jean Sibelius und all die anderen grossen Komponisten um sich herum.
Wie hat sich Stenhammar für diese Komponisten eingesetzt?
Die schwierigste Sibelius-Sinfonie für das Publikum ist die Nr. 4. Die erste Sinfonie lieben alle. Das sind so ein bisschen zirkushafte, sehr hinreissende, bewegende Stücke, sehr pathetisch, grossartig. Aber die Vierte ist ganz anders. Eigenbrötlerisch, nicht wahr? Das Publikum hat gar nichts verstanden, und damals in Göteborg sind die meisten nach dem ersten Satz rausgegangen. Sie haben nicht gebuht oder so, aber sie haben gesagt: Das ist nichts für uns, das können die anderen hören. Und nach dem zweiten Satz gingen wieder einige raus, und so weiter. Am Ende war nur noch eine Handvoll Leute im Saal. Aber Stenhammar war überzeugt: Das ist ein Meisterwerk. Er wollte das nicht hinnehmen – auch er war trotzig. Und was hat er gemacht? Etwas Grossartiges! Er hat einen Artikel in der Tageszeitung geschrieben, sehr freundlich: «Liebe Freunde, Sie wissen gar nicht, was Sie verpasst haben. Ich gebe Ihnen aber eine Chance. Nächste Woche ändern wir das Programm und spielen nochmals diese Sinfonie.» So macht das ein freundlicher Mann des Trotzes, ein Kämpfer! Seine Reaktion ist nicht: Ja, dann spielen wir halt nicht so viel von dieser Musik, damit die Leute immer zufrieden sind. Nein, nein, die müssen das hören. Und was passierte? Alle im Publikum blieben. Er hatte Erfolg mit seinem Trotz. So kann man sich einsetzen für Sachen, an die man glaubt.
Wir haben gerade von Göteborg gesprochen: Dort befindet sich der Grossteil Ihrer Bibliothek – 500 Laufmeter Partituren, Bücher, Tonträger. In dem kleineren Teil sitzen wir mittendrin. Was bedeutet Ihnen Ihre Bibliothek?
Das hat natürlich angefangen mit Noten, wenn man so viel Neugier für Musik hat. Bevor ich als Dirigent debütierte, war ich ja Musikwissenschaftler. Es steht vieles zur Verfügung in Büchern. Ausserdem war ich in so vielen Ländern tätig, Schweden war ja nur der Anfang: Die nächsten Jahre war ich in Norwegen, die folgenden zehn Jahre in Kopenhagen, dann 15 Jahre in Dresden und dann in Amerika. Da hat man immer das Bedürfnis, sich mit diesen neuen Kulturen zu beschäftigen. Ich kann ja nicht Chefdirigent sein in einem Land und die Kultur nicht kennen. Wenn ich Entscheidungen zu treffen habe, dann muss ich das balancieren mit dem, was ich von diesen Leuten weiss, welche Gefühle und welche Kultur sie als Hintergrund haben, um dem gerecht zu werden, was sie brauchen. Also auch da musste ich sehr viel lesen. Ich erinnere mich noch besonders daran, wie es war, als ich nach Kopenhagen kam: Ich hatte wenig Ahnung von dänischer Malerei, Philosophie, der Literatur, aber ich hatte schon von Søren Kierkegaard gehört – dem grossen Philosophen. Schon am ersten Tag habe ich seine sämtlichen Werke gekauft, das sind 22 Bände. Das war natürlich sehr optimistisch (lacht). Aber ich fand, das war sehr spannend. Und dadurch wächst dann natürlich die Bibliothek auch sehr schnell. Jetzt bin ich seit 25 Jahren pensioniert und habe, weil ich keine administrativen Aufgaben habe, etwas mehr Zeit, meinem Wissensdrang gerecht zu werden. Das hört eigentlich nie auf.
Was lesen Sie aktuell?
Da auf dem Tisch liegt viel, viele wunderbare Bücher, Folianten. Das sind Kunstbücher. Ganz aktuell: Ich hatte vor ein paar Stunden Besuch von einem Antiquar aus Berlin, einem sehr guten Freund. Ich hatte bei ihm zwei Sachen bestellt, die mich sehr interessiert haben. Das eine war das «Stunden-Buch» von Rainer Maria Rilke. Dieses Buch habe ich eigentlich schon lange, aber in der dritten Auflage. Ich weiss sogar noch, was ich dafür bezahlt habe: 65 Euro in einem Leipziger Antiquariat. Sehr schön, kleinformatig. Nun das Buch in der ersten Auflage in der Hand zu haben, ist wunderbar. Wunderbar. Warten Sie, ich lese Ihnen etwas daraus vor: «Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise jahrtausendelang; und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang.» Der Sinn ist: Der Turm ist ein Sinnbild von Gott, etwas Festes. Und um den Turm herum fliegen Falken. Die haben ihre Nester in dem Turm gebaut. Sicherheit in Gott. Er sucht auch Sicherheit in Gott. Ich kreise um diesen Turm, und er kreiste Jahrtausende lang. Das bedeutet nicht nur er, sondern alle Künstler*innen suchen Gott – offen oder verdeckt, auch wenn sie das nicht wissen. Bin ich nur ein Falke? Oder bin ich ein Sturm? Man klagt ihn an, und man schimpft auf Gott, und alles Mögliche. Oder ein grosser Gesang? Es gibt nur eine letzte Möglichkeit: Gott ist Gott und ich bin nur ein kleiner Mensch. Ein sehr schönes Gedicht, voll von Sinn in wenigen Zeilen.
Sie waren in Leipzig Gewandhauskapellmeister. Welche Erinnerungsstücke an frühere Stationen wie Dresden, San Francisco und Stockholm umgeben Sie hier in Luzern?
Ich kenne ja viele Künstler*innen aus den Orchestern. Und einige haben mir kleine selbst gemachte Kunstwerke geschenkt. Von einem Musiker in Leipzig, Felix Ludwig, habe ich etwas sehr Schönes: (Geht zu seinem Flügel.) Das ist eine kleine Bronzestatue von Mendelssohn. Da sitzt er auf meinem Flügel: auf einem Hocker, mit der Partitur in der Hand und einem Taktstock. Nach einer Probe sieht er ein bisschen müde aus. Und ich unterhalte mich manchmal mit ihm und hole mir Ratschläge. Davon gibt es nur zwei Exemplare. Einiges habe ich auch gekauft, wie diese Büste von Arthur Nikisch – einer meiner Vorgänger als Gewandhauskapellmeister. (Zeigt auf eine Keramik.) Das hier ist Keramik von der Frau von Ingvar Lidholm, dem grossen schwedischen Komponisten, sicher dem grössten Komponisten in Schweden nach Stenhammar. Ich habe in Stockholm im Januar ein Gedenkkonzert dirigiert, mit vielen Werke von ihm. Ich habe darauf bestanden, dass das auch im Fernsehen kommen muss, damit die Leute nicht vergessen, dass da ein besonders grosser Komponist ist. Auch ein bisschen Trotz (lacht).
Diese Malerei hat ein Künstler aus San Francisco gemacht. (Zeigt auf ein grossformatiges Aquarell.) Er heisst Gary Bukovnik, ein grosser Musikliebhaber. Er hat jedes Jahr für San Francisco Symphony ein Poster gemacht mit Blumen, er malt nur Blumen, Aquarelle. Nach meinen zehn Jahren als Chef in San Francisco hat er mir dieses Bild gemalt: Das sind zehn Blumensträusse. Das Bild hier hat mir die Staatskapelle Dresden geschenkt, als ich Chef wurde: Das ist eine biblische Geschichte, von Hans Jüchser. Das ist der König Salomo, der ja berühmt war für seine Weisheit. Zwei Mütter sind zu ihm gekommen, und die eine sagte, das ist mein Kind. Die andere: Nein, das ist mein Kind.
Das salomonische Urteil.
Ja, ja, das ist das. Und das Orchester hat mir dieses Bild geschenkt, als ich Chef wurde. Sie hofften, dass ich auch salomonische Urteile sprechen kann. Denn es gibt viel Bedarf dafür (lacht).
Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag über die Jahrzehnte verändert?
Nicht sehr. Der Alltag war schon immer sehr dicht getaktet und ist es noch. Gerade bin ich aus den USA zurück und reise weiter nach Schweden. Ein normaler Tag ist: Um zehn Uhr habe ich Probe. Davor frühstücke ich und erledige geschäftliche Dinge. Ich möchte eine halbe Stunde vor der Probe da sein, und dann ist Probe. Vielleicht eine oder zwei Proben bis ca. vier Uhr nachmittags. Und dann geht es wieder nach Hause. Ich bin ja alleine, ich koche selbst. Das ist auch Abwechslung, das macht Spass. Ich esse so viel in Restaurants. Wenn ich hier bin, dann möchte ich so viel Zeit wie möglich zu Hause verbringen.