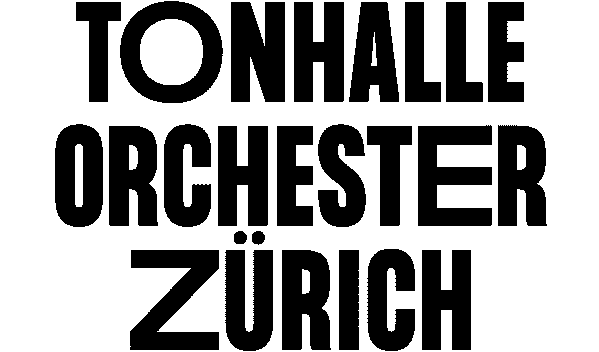«Wiegenlied des Todes»
Kaum etwas hat so viel Aussagekraft über ein Werk wie die Worte des Komponisten. Was hat Gabriel Fauré über sein berühmtes Requiem gesagt? Und was verbirgt sich hinter den Zitaten?
Es ist wohl das populärste Werk von Gabriel Fauré: das Requiem op. 48. Der Musiker hat kaum Skizzen hinterlassen, die etwas über die Entstehung der Komposition verraten würden. So müssen viele Fragen, die wir uns heute dazu stellen, unbeantwortet bleiben. Ganz im Dunkeln tappen wir jedoch nicht: In Briefen und Gesprächen machte Fauré einige spannende Aussagen zu seinem Requiem, die auch etwas über den Charakter des grossen französischen Komponisten preisgeben.
«Mein Requiem wurde ‹ohne Anlass› komponiert …, zu meinem Vergnügen, wenn ich so sagen darf! Es wurde erstmals um 1890 in der Madeleine zu einer Totenfeier für irgendein Gemeindemitglied aufgeführt. Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann!»
Diese Zeilen, die Fauré im März 1910 an den französischen Musikwissenschaftler Maurice Emmanuel schrieb, sind ebenso informativ wie provokativ. Schuf er wirklich eine Totenmesse zum «Vergnügen»? Wahrscheinlicher ist, dass ihn ein äusserer Anlass zu seinem Werk inspiriert hat. Immerhin waren 1885 sein Vater und 1887 auch seine Mutter gestorben. Genau in dieser Zeit arbeitete er an seinem Requiem.
Seit 1877 war Gabriel Fauré als Kantor an der Pariser Pfarrkirche La Madeleine tätig, 1896 wurde er zum Organisten an der Hauptorgel – eine Arbeit, die ihm nicht immer gefiel und die er oftmals als Last empfand. Denn eigentlich war die Kirche nicht seine Welt: Fauré war Agnostiker. Dennoch schrieb er ein Requiem, das damals – am 16. Januar 1888 – jedoch nicht zur «Totenfeier für irgendein Gemeindemitglied aufgeführt», sondern beim feierlichen Gedenkgottesdienst «erster Klasse» zum Jahrestag der Bestattung des Architekten Joseph- Michel Le Soufaché, der unter anderem an dem von Louis-Philippe I. angeordneten Umbau des Schlosses von Versailles beteiligt gewesen war.
Und Fauré hat in seinem Brief an Emmanuel noch mehr ausgelassen: Er überarbeitete das Requiem über einen Zeitraum von 14 Jahren nämlich mehrfach und schuf daher verschiedene Versionen. Höhepunkt war wohl die Wiedergabe im Jahr 1900, als das Werk in der letzten Fassung bei der Pariser Weltausstellung vor ungefähr 5000 Zuhörer*innen erklang.
«Vielleicht habe ich instinktiv versucht, dem Konventionellen zu entgehen. So lange Zeit schon begleite ich an der Orgel die Beerdigungsmessen! Ich habe genug davon und wollte etwas anderes machen.»
Aus den Worten Faurés aus dem Jahr 1902 lassen sich die Langeweile und die Frustration des Komponisten deutlich herauslesen. Letztere wird sich nach der Uraufführung des Requiems noch verstärkt haben. Der Vikar kam nämlich auf ihn zu und meinte nur: «Monsieur Fauré, wir brauchen all diese Neuerungen nicht; das Repertoire der Madeleine ist reich genug.» Das befreiende Gefühl, endlich nicht mehr in der immer gleichen Wiederholungsschleife gefangen zu sein, wird schnell Ärger gewichen sein. Der Stil der Opéra comique galt damals als das Nonplusultra – auch im Gottesdienst. Fauré hingegen schrieb eher eine intimere Musik. So verarbeitete er das musikalische Material seines Requiems mehr auf kammermusikalische Weise.
Diese Haltung des Vikars und Faurés Musikverständnis werden der Grund dafür sein, dass der Komponist, obwohl er insgesamt 40 Jahre lang (1865–1905) im Dienst der katholischen Kirche stand, nur 26 Kirchenmusikwerke und keine Orgelmusik verfasst hat. Mit Ausnahme seines Requiems handelt es sich dabei fast nur um kurze Kompositionen. Und nur zehn von ihnen entstanden in den fast dreissig Jahren, in denen Fauré bei der vornehmen Gemeinde von La Madeleine angestellt war.
«Man hat gesagt, dass es keine Angst vor dem Tod ausdrücke; jemand hat es ein ‹Wiegenlied des Todes› genannt. Doch so empfinde ich den Tod: als glückliche Befreiung, als Streben nach dem jenseitigen Glück eher denn als schmerzhaften Übergang.»
Das Requiem weist mehrere Besonderheiten auf. Dazu gehört eine positive und tröstende Grundstimmung, da Fauré auf das «Dies irae» («Tag des Zorns») verzichtete – und damit auf den Höhepunkt vieler Requiems, denken wir etwa an jene von Mozart oder Verdi. Doch damit nicht genug: Fauré setzte einen neuen Teil an den Schluss. So endet das Requiem nicht mit Schrecken («Dies irae»), sondern mit dem Paradies («In paradisum»), das traditionellerweise eigentlich bei der Überführung des Leichnams von der Kirche zum Friedhof gesungen wird. Die obige Aussage Faurés über sein Requiem trifft also sowohl den Kern des Werks als auch jenen seiner Persönlichkeit. Und so war es wohl eine Selbstverständlichkeit, dass das Requiem bei Faurés Beerdigung im Jahr 1924 gespielt wurde. Immerhin war er der Meinung, es sei «von sanftmütigem Charakter, so wie ich selbst».
«Super flumina Babylonis» (Psalm 136)
Gabriel Fauré (1845–1924) war ein wichtiger Erneurer der französischen Musik, ein ausgezeichneter Organist und auch ein hervorragender Lehrer (u.a. von George Enescu, Nadia Boulanger und Maurice Ravel). In den letzten Jahren wird er allmählich neu entdeckt, seine Werke werden wieder häufiger gespielt. Aber es gibt noch Raritäten, und mit «Super flumina Babylonis» stellt Paavo Järvi eine davon dem berühmten Requiem gegenüber. Die Vertonung des Psalms 136 für Sopran, Tenor, gemischten fünfstimmigen Chor und Orchester war das erste Kirchenmusikwerk, das Fauré verfasste. Er schrieb es im Juli 1863 für den Jahresendwettbewerb der École de musique classique et religieuse. Bei der Jury kam es gut an: Es erhielt die Bewertung «sehr ehrenhaft», vom Musikkritiker des «Ménestrel» wurde es als «überaus bemerkenswert» bezeichnet. «Super flumina Babylonis» stellt in vielerlei Hinsicht eine Besonderheit dar: Es ist eines der drei grossen Kirchenmusikwerke, die Fauré verfasste (zwei Jahre später folgte die Komposition «Cantique de Jean Racine», erst 14 Jahre später das Requiem) und ein Zeugnis für seinen frühen Stil, der noch an Brahms oder Berlioz erinnert.