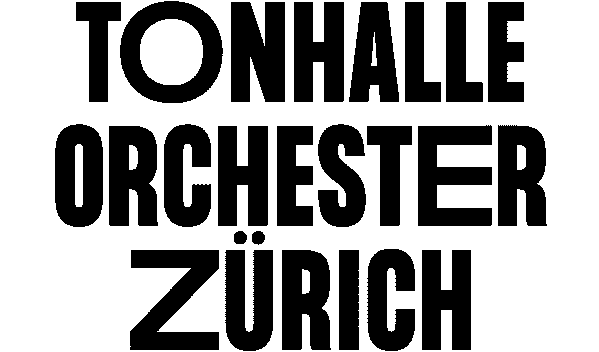Die Ausnahmen von der Regel
Die Kammermusik-Lunchkonzerte bieten in dieser Saison eine Hommage an Frankreich – und rücken dabei auch fünf Komponistinnen in den Fokus.
Das Talent ist das eine – die Möglichkeit, es zu entwickeln, etwas ganz anderes: Das zeigt sich in der Musikgeschichte besonders deutlich. Rein statistisch kann man davon ausgehen, dass es zu Zeiten von Bach, Beethoven oder Berg auch Frauen gegeben haben muss, die ähnlich begabt waren. Doch selbst jene, die eine musikalische Ausbildung erhielten, hatten bis weit ins 20. Jahrhundert kaum eine Chance, ihre Werke ausserhalb eines hausmusikalischen Rahmens aufzuführen, auf grossen Bühnen Erfahrungen zu sammeln, mit bedeutenden Interpret*innen zusammenzuarbeiten. Dass die meisten Komponistinnen vor allem Kammermusik schrieben, ist deshalb kein Zufall. Dass viele sich stilistisch eher in Richtung Vergangenheit orientierten, ebenfalls nicht: Wer nicht in aktuelle Diskussionen einbezogen wird, kann auch wenig dazu beitragen. Der Traum, irgendwo auf einem Estrich den Nachlass eines weiblichen Mozarts zu entdecken, wird darum leider ein Traum bleiben.
Was hätte sein können: Das zeigen aber immerhin jene Ausnahmen von der Regel, die es durchaus gab. Und man kann es immer öfter hören, denn Musikerinnen und Veranstalterinnen haben schon länger damit begonnen, Werke von Komponistinnen aus der Versenkung zu holen; inzwischen interessieren sich auch Musiker und Veranstalter zunehmend für ihr Schaffen. Und längst muss man nicht mehr für jede Entdeckung in die Archive steigen, denn verschiedene Verlage beteiligen sich an dieser Renaissance.
In den vergangenen Monaten haben sich auch Musiker*innen des Tonhalle-Orchesters Zürich in diesem Repertoire umgesehen. Denn das Thema der von ihnen betreuten Kammermusik-Lunchkonzerte, das dieses Jahr «Hommage an Frankreich» lautet, hatte in der Ausschreibung eine ergänzende Klammerbemerkung: (Mit Fokus auf französische Komponistinnen).
«Wunder unseres Jahrhunderts»
Eine dieser Komponistinnen ist Élisabeth-Claude Jacquet de la Guerre (1665–1729). Sie ist ein Paradebeispiel für die erwähnten Ausnahmen: Als Tochter eines Musikers erhielt sie dieselbe Ausbildung wie ihre Brüder – und hatte dazu eine Extraportion Glück. Denn sie durfte als fünfjähriges Wunderkind dem Sonnenkönig Louis XIV ihre Cembalo-Künste vorführen, und dieser war so begeistert von ihr, dass er sie sein Leben lang unterstützte. Er ermöglichte ihr unter der Obhut seiner Maitresse Madame de Montespan eine fundierte aristokratische Ausbildung am Hof, wo sie regelmässig als gefeierte Interpretin und Improvisatorin auftrat. Ausserdem finanzierte er die Publikation ihrer Werke und verschaffte ihr Aufführungsmöglichkeiten, die ihr wiederum öffentliche Aufmerksamkeit eintrugen: In der Zeitschrift «Le Mercure Galant» etwa wurde sie als «merveille de notre siècle», als «Wunder unseres Jahrhunderts » gefeiert.
1684 heiratete sie einen Musiker, wurde Mutter und verliess Versailles, aber der Kontakt blieb bestehen: Darauf deutet schon hin, dass sie bis zum Tod des Sonnenkönigs alle ihre Werke ihm widmete. Dazu gehörte auch ihre einzige Oper «Céphale et Procris», die 1694 im Palais Royal, dem damaligen Haupt-Spielort der Pariser Oper, zur Uraufführung kam. Aus damaliger Sicht war sie kein grosser Erfolg, aus musikhistorischer Perspektive dagegen eine Sensation: Es sollte einige Jahrhunderte dauern, bis eine Komponistin eine ähnlich grosse Bühne bespielen konnte.
Auch in ihren kammermusikalischen Werken spiegelt sich die gezielte Förderung: Élisabeth-Claude Jacquet de la Guerre trug als eine der ersten mit zum Trend bei, den französischen Stil durch italienische Einflüsse anzureichern. Wie sehr sie musikalisch auf der Höhe der Zeit war, zeigt auch die Trio-Sonate, welche Elisabeth Bundies für das erste Kammermusik-Lunchkonzert ausgewählt hat: «Der Umgang mit Dissonanzen und die unerwarteten harmonischen Wendungen verraten einiges über ihre Selbstsicherheit », sagt die Geigerin. Dasselbe gilt für den Umfang dieses Werks: «Es dauert rund acht Minuten, während von anderen französischen Barock-Komponistinnen fast nur Mini-Stücke überliefert sind.»
«Unbestreitbare Überlegenheit»
Eine ähnlich ideale Förderung bekamen rund 200 Jahre später die Schwestern Nadia und Lili Boulanger (1887–1979 bzw. 1893-1918), die in zwei weiteren Lunchkonzert-Programmen zu entdecken sein werden. Auch sie hatten bestens vernetzte Musiker-Eltern, zu den Freunden der Familie gehörten Komponisten wie Camille Saint-Saëns und Charles Gounod. Die Schwestern erhielten Orgelunterricht bei Louis Vierne und Kompositionsunterricht bei Gabriel Fauré. Und die Resultate liessen nicht lange auf sich warten: So wurden etwa beide mit dem begehrten Prix de Rome ausgezeichnet.
Lili Boulanger, die jüngere der Schwestern, erhielt ihn 1913 als erste Komponistin überhaupt. Was das bedeutet haben muss, beschrieb Émile Vuillermoz damals in der Zeitschrift «Musica»: Die 19-Jährige habe überzeugt «mit Souveränität, Tempo und Leichtigkeit; was die übrigen Kandidaten einigermassen verstört zurückgelassen hat, schwitzten sie doch seit Jahren Blut und Wasser, um sich dem Preis unverdrossen zu nähern». Der Sieg sei hart verdient gewesen, denn «die Frauenfeindlichkeit der Jury war bekannt». Entsprechend sei ihre Kantate «mit gnadenloser Aufmerksamkeit » gehört worden, «was ihr in dieser Atmosphäre den Stellenwert einer beeindruckenden und bedrohlichen feministischen Präsentation gab. Und es bedurfte der überwältigenden und unbestreitbaren Überlegenheit dieses Werks einer Frau, um über die Hausaufgaben der Studenten, in deren Gesellschaft sie sich befand, zu triumphieren».
Auch Christian Proske, Stellvertretender Solo-Cellist, ist beeindruckt von Lili Boulanger, «vor allem davon, wie forschrittlich sie komponierte: In den Klaviertrios ‹D’un soir triste› und ‹D’un matin de printemps›, die wir spielen, hatte sie den Impressionismus eigentlich bereits hinter sich gelassen und tendierte sehr in die Richtung, die später die Musik des ‹Groupe des Six› um Francis Poulenc, Darius Milhaud und Germaine Tailleferre prägte». Da stelle man sich schon die Frage, was aus ihr noch hätte werden können: «Aber leider gehören diese Werke zu ihren letzten.» Im März 1918 starb die Komponistin, die ihr Leben lang an einer chronischen Bronchopneumonie und an Morbus Crohn gelitten hatte, mit nur 24 Jahren.
Einen weit längeren Weg machte ihre Schwester Nadia, von der in einem anderen Programm drei Stücke für Cello und Klavier zu hören sein werden: Sie wurde 92 Jahre alt, schaffte eine erfolgreiche Karriere als Pianistin, eine beachtliche als Komponistin und eine wegweisende als Dirigentin. Vor allem aber war sie eine der gefragtesten Musikpädagoginnen des 20. Jahrhunderts: Zu ihren Schüler*innen, denen sie neben technischen Fähigkeiten vor allem musikalische Eigenständigkeit zu vermitteln versuchte, gehörten Aaron Copland und Astor Piazzolla, Grażyna Bacewicz und Quincy Jones (der später unter anderem Michael Jacksons Album «Thriller» produzierte), der Strawinsky- Sohn Swjatoslaw Sulima und Philip Glass.
Karriere mit Unterbrechungen
Drei Jahrzehnte vor den Boulanger-Schwestern hatte auch eine andere Komponistin einen vielversprechenden Start in eine Laufbahn, die sich dann allerdings als typisch weiblicher Hindernislauf entwickelte: Das war Mel Bonis (1858–1937), die eigentlich Mélanie hiess, aber ihre Werke bewusst unter dem verkürzten und so nicht mehr als weiblich identifizierbaren Vornamen publizierte. Sie wurde schon früh von César Franck gefördert und war eine Studienkollegin von Claude Debussy – bis ihre Eltern sie dazu drängten, wegen einer Liebesbeziehung mit einem Sänger ihr Studium abzubrechen und einen 22 Jahre älteren, zweifach verwitweten Industriellen zu heiraten.
Mel Bonis zog dann dessen fünf Kinder auf und wurde selbst offiziell zweifache Mutter. Ein drittes Kind aus ihrer heimlichen Beziehung mit dem Sänger, den sie nach Jahren wieder getroffen hatte, musste sie Pflegeeltern überlassen; sie blieb aber als «Freundin der Mutter» in Kontakt mit dieser Tochter. Erst mit über 40 Jahren begann sie wieder zu komponieren, gewann Wettbewerbe, beeindruckte Camille Saint-Saëns, wurde als erste Frau zur Sekretärin der französischen Société des compositeurs de musique gewählt. Über 300 Werke hat sie geschaffen, viele davon für Klavier oder kammermusikalische Besetzungen. Aufgeführt wurden sie zu ihrer Zeit jedoch kaum. «Mein grosser Kummer: nie meine Musik hören», schrieb sie in einem Brief an ihre Tochter.
In einem der Kammermusik-Lunchkonzerte kann nun immerhin das Zürcher Publikum ihre Musik hören, genauer gesagt ihr Pièce op. 189 für Flöte und Klavier, das die Harfenistin Sarah Verrue für Flöte und Harfe bearbeitet hat. Dazu gibt es auch noch «Un soir de septembre» für Sopran, Flöte, Viola und Harfe einer anderen Mélanie, nämlich Claire-Mélanie Sinnhuber: Sie wurde 1973 geboren – und kann ihre Werke selbstverständlich unter ihrem vollen Namen veröffentlichen.