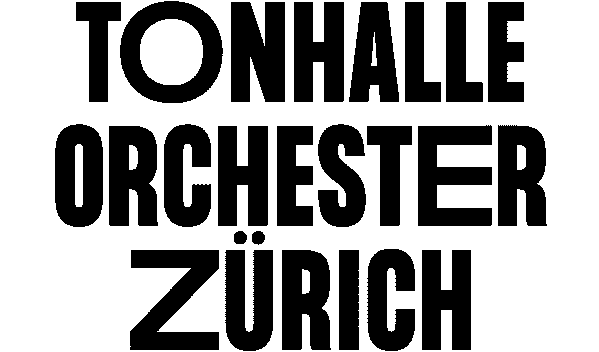Wie erzählt ein Orchester von Liebe?
Tja, schwierig. Ausser, es geht um Romeo und Julia.
Man kann es ja verstehen: Wenn Komponisten eine Liebesgeschichte erzählen wollen, schreiben sie in der Regel eine Oper. Auf der Bühne lassen und liessen sie alle möglichen Paare flirten und leiden, heiraten und sterben. Orpheus und Eurydike, Nero und Poppea, Jupiter und Calisto, Elisabeth I. und Roberto Devereux, Tosca und Cavaradossi, Violetta und Alfredo, Tristan und Isolde, Mimì und Rodolfo, Pelléas und Mélisande … und ja, natürlich: Romeo und Julia.
Das berühmteste aller Liebespaare hat eine durchaus vielseitige Bühnenkarriere gemacht. Die bekanntesten Versionen sind jene von Bellini und Gounod (letztere gibts demnächst im Opernhaus Zürich) – und natürlich Leonard Bernsteins Musical «West Side Story», in dem die beiden von Verona nach New York versetzt wird. Weitgehend vergessen ist dagegen die frühere Romeo-und-Julia-Oper von Georg Anton Benda (dabei hatte sie ein Happy End!). Und auch die Opern von Riccardo Zandonai, Heinrich Sutermeister und Boris Blacher werden nur sehr selten gespielt.
Wenn Liebe, dann Shakespeare
Was Romeo und Julia von den anderen Liebespaaren unterscheidet, ist aber nicht ihre Bühnenpräsenz – sondern die Tatsache, dass sie immer wieder auch in sinfonischen Programmen auftauchen. Nicht, dass sie gleich dutzendfach mit Orchesterwerken geehrt worden wären; die Liebe wird in den Konzertsälen nun mal vorwiegend in Form von versteckten Liebesbotschaften zelebriert. Aber wenn sich Sinfoniker offiziell amourösen Stoffen zuwandten: Dann ging es sehr oft, ach was: fast immer um Shakespeares Paar.
Bei Hector Berlioz zum Beispiel. Der sah Shakespeares Stück einst im Pariser Odéon-Theater, verliebte sich in Julia (respektive in deren Darstellerin Harriet Smithson) und komponierte darauf seine Symphonie dramatique «Roméo et Juliette», ein überaus eigenwilliges Orchesterwerk mit Chor und drei solistischen Vokalpartien. Ganz ohne Gesang kam er bei diesem Thema – obwohl er es nicht als Oper verarbeiten mochte – also doch nicht aus.
Auch Prokofjews «Romeo und Julia» ist streng genommen kein rein instrumentales Werk; es entstand als Ballett. Aber immerhin, die Musik wird in schönster Regelmässigkeit auch ohne Tänzer*innen in sinfonischen Programmen gespielt (und der «Tanz der Ritter» zusätzlich auch noch in jedem zweiten Wunschkonzert). So auch im Silvesterkonzert des Tonhalle-Orchesters Zürich, in dem gleich drei Suiten aus Prokofjews Ballett mit einem weiteren Romeo-und-Julia-Werk kombiniert werden: mit Tschaikowskys Fantasieouvertüre «Romeo und Julia» nämlich.
Schlagzeug-Schlägerei und folkloristische Anklänge
Dies ist nun tatsächlich ein rein orchestrales Werk, ohne Text, ohne Tanz; geliebt und gestorben wird ausschliesslich in Tönen – wobei Tschaikowsky mit choralartigen Passagen, einer Schlagzeug-Schlägerei, folkloristischen Anklängen und einem Trauermarsch durchaus konkrete Szenerien aufbaut.
Ursprünglich hatte Tschaikowsky übrigens daran gedacht, eine Romeo-und-Julia-Oper zu schreiben. Dass es nie dazu kam, ist vielleicht das schönste Plädoyer für rein instrumentale Liebesgeschichten: Wenn ein begnadeter Opernkomponist wie Tschaikowsky Shakespeares Paar lieber orchestral würdigt – dann sagt das einiges aus darüber, was sich allein mit Tönen alles ausdrücken lässt.