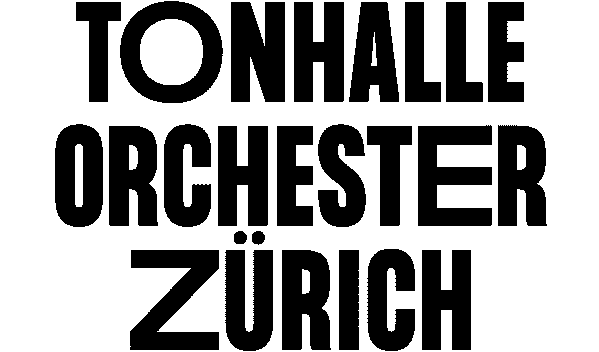Sie sind immer noch irgendwo die ersten
Zwei Debüts, eine Rückkehr: Mit Simone Young, Joana Mallwitz und Alondra de la Parra reisen in dieser Saison gleich drei prominente Dirigentinnen an.
«Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo man einfach nicht mehr zu viel darüber reden sollte»: So antwortet Joana Mallwitz, wenn sie wieder einmal gefragt wird, wie es denn so sei als Dirigentin. Aber ein bisschen muss man eben doch noch darüber reden. Denn die Pionierinnen-Phase ist noch nicht vorbei, selbst wenn immer mehr Frauen auf dem Podium stehen und der Nachwuchs in den Dirigierklassen inzwischen vielerorts zur Hälfte weiblich ist.
Das zeigt sich schon bei der Lektüre der Biografien: Fast jede Dirigentin kann schreiben, sie sei irgendwo die Erste, die Jüngste, die Einzige gewesen. Ihre männlichen Kollegen müssten sich schon einiges einfallen lassen, um solche Premieren vermelden zu können – einen neuen Saal eröffnen etwa, oder die «Alpensinfonie» rückwärts spielen. Alles andere machen ihre Vorgänger seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten.
So ist es nichts Besonderes, dass auch die drei Dirigentinnen, die in dieser Saison vor dem Tonhalle-Orchester Zürich stehen werden, gleich mehrere «erste Male» auflisten können. Simone Young (*1961), die zur ersten Generation der wirklich erfolgreichen Dirigentinnen gehört, leitete unter anderem als erste Frau die Hamburgische Staatsoper, stand als Erste vor den Wiener Philharmonikern und im Orchestergraben der Pariser Bastille-Oper – und ist wohl die erste Grossmutter auf den internationalen Podien. Joana Mallwitz (*1986) war mit 27 Jahren in Erfurt die europaweit jüngste Generalmusikdirektorin, betreute als erste Frau eine Opernproduktion bei den Salzburger Festspielen und ist neu die erste Chefdirigentin des Konzerthausorchesters Berlin. Und Alondra de la Parra (*1980) startete als erste mexikanische Dirigentin durch und war die erste Generalmusikdirektorin in Australien.
Soweit die Schlagzeilen. Weit spannender ist der Rest: Wie sie auf das Podium gekommen sind. Und was sie dort zu bieten haben.
Simone Young, Känguru
Bei Simone Young wies zunächst rein gar nichts auf eine Musikerinnen-Karriere hin. Ihr Vater war Anwalt, die Mutter Schneiderin, und in der Familienwohnung in Sydney gab es weder einen Plattenspieler noch Instrumente. Als die kleine Simone Klavierstunden nehmen wollte, durfte sie das zwar – aber zunächst hatte sie nur eine Papiertastatur zum Üben.
Ob vielleicht gerade das die klangliche Vorstellungskraft weckte, die sie heute als Dirigentin hat? Jedenfalls geht sie bei ihren Auftritten genau davon aus: «Man muss so ein starkes, klares Bild des Klangs haben, den man erwartet, dass es keinen Platz für Missverständnisse gibt», hat sie einmal in einem Interview mit der «Süddeutschen Zeitung» gesagt.
Der Weg von der Papiertastatur zum Taktstock war allerdings weit. Simone Youngs Talent wurde zwar früh erkannt, aber mehr als eine Karriere als Assistentin war für Frauen damals nicht vorgesehen. Ihr Glück war, dass sie 1991 Assistentin von Daniel Barenboim wurde. Und dieser war so beeindruckt von ihrem Fleiss und ihrem Willen, den Werken gerecht zu werden, dass er sie weiterempfahl. Zum Beispiel den Wiener Philharmonikern, die sie 1993 erstmals dirigierte – zu einer Zeit also, als dieses Orchester noch keine Musikerinnen aufnahm.
Es habe ihr geholfen, so sagt sie, dass sie «ein Känguru war, ein Exot: Australien war damals noch viel weiter weg als heute, insofern durfte ich anders sein». Nicht nur in dieser Formulierung zeigt sich der Humor, mit dem Simone Young ihr «Anderssein» zu kommentieren pflegt. Auch im Dokumentarfilm «Knowing the Score» – den übrigens Cate Blanchett produzierte, die Protagonistin im Dirigentinnen- Film «Tár» – liefert sie durchaus bissige Kostproben davon. Etwa wenn sie sich daran erinnert, wie sie in der Wiener Staatsoper hochschwanger einen «Lohengrin» dirigierte und beim Blick in das damals noch ausschliesslich männliche Orchester feststellte, dass ihr Bauch keineswegs der grösste war.
«Lohengrin» mit den Wienern: Die Konstellation ist typisch für Simone Young. Sie liebt die grossen Werke und Adressen, sie will gehört werden, etwas bewirken, entscheiden. In den Proben, in denen sie ihre Ziele direkt und schnörkellos anpeilt. Und auch als Chefin: An der Hamburger Staatsoper war sie Intendantin und Generalmusikdirektorin in Personalunion – ein aufreibender Job, in dem sie einigen Gegenwind auszuhalten hatte.
Inzwischen ist sie als Chefdirigentin des Sydney Symphony Orchestra oft wieder am anderen Ende der Welt unterwegs. Sie erzählt in der «Zeit» mit durchaus subversivem Vergnügen, dass sie neuerdings stricke, für ihre Enkelin. Und nimmt in Europa nur noch jene Engagements an, die sie wirklich interessieren: in der Berliner Philharmonie etwa, an der Mailänder Scala – und im November 2023 erstmals bei uns.
Joana Mallwitz beobachtete Simone Young bereits als Teenager – und beschloss nicht zuletzt ihretwegen, Dirigentin zu werden. Allerdings eine ganz andere Dirigentin als ihr einstiges Vorbild.
Joana Mallwitz, Zusammenarbeiterin
Diese Karriere beeindruckte einst auch Joana Mallwitz. Die Hildesheimerin beobachtete Simone Young bereits als Teenager – und beschloss nicht zuletzt ihretwegen, Dirigentin zu werden. Allerdings eine ganz andere Dirigentin als ihr einstiges Vorbild.
Auch wenn Joana Mallwitz’ Name seit ihrer «Così fan tutte» an den Salzburger Festspielen 2020 international geläufig ist: Das Rampenlicht interessiert sie weit weniger als die «richtige Entscheidung ». So übernimmt sie nun das Konzerthausorchester Berlin, die Nummer zwei in der Stadt hinter den Berliner Philharmonikern. Natürlich wisse sie, womit man da verglichen werde, sagte sie in einem Interview. Aber ihr Bauchgefühl sei klar gewesen: «Hier möchte ich die nächsten Jahre sein, mit denen können wir was reissen und entwickeln. Es fühlte sich wie der nächste, richtige Ort an.»
Schon der letzte Ort, das Staatstheater Nürnberg, war ein «richtiger» Ort gewesen. Hier konnte Joana Mallwitz vieles ausprobieren, etwa in den «Expeditionskonzerten », in denen sie Werke vorstellte, die sie zeitgleich in den Abo-Reihen dirigierte. Das Orchester spielte Stellen an, sie erzählte etwas darüber und setzte sich auch mal ans Klavier, um etwas zu zeigen.
Das Format wurde Kult, der Saal war voll, das Publikum bunt gemischt. Joana Mallwitz, die sich selbst als «neben der Bühne eher verschlossen» bezeichnet, gewöhnte sich daran, vor Publikum zu sprechen. Und als Corona kam, versetzte sie die «Expeditionskonzerte» so geschickt in die digitale Welt, dass zum Beispiel die Ausgabe zu Beethovens 8. Sinfonie auf YouTube über 500’000 Mal aufgerufen wurde.
Aus einem ergibt sich das andere, so ist das bei ihr. Schritt für Schritt, über das Klavier und Repetitions-Stellen wurde sie zur Dirigentin; und Schritt für Schritt macht sie weiter. Ihr Ziel ist nicht das Abhaken möglichst vieler glamouröser Debüts, sondern die Wiedereinladung. Wenn sie im Juli 2024 das erste Mal vor dem Tonhalle-Orchester Zürich stehen wird, dann könnte das der Beginn einer längerfristigen Zusammenarbeit sein.
Zusammenarbeit: Dieses Stichwort ist zentral für sie. Wie sehr Joana Mallwitz das Musizieren als vertrauensvolles Miteinander versteht, verrät die Art, wie sie darüber spricht. «Meisterwerke lassen einen nicht im Stich, sie tragen einen weiter», sagte sie zum Beispiel in der TV-Sendung «KlickKlack». Oder dass sie «aufgefangen» wird vom Orchester. Und ja, die Folgen dieser Haltung sind in ihren Aufführungen durchaus zu hören.
Alondra de la Parra, Poetin
Auch Alondra de la Parras Formulierungen verraten viel von ihr. «Ich tanze nicht, ich führe», sagte sie einst, als ein Interviewer sie auf ihre Gestik ansprach. Und ein knapper Satz genügte ihr, um klarzumachen, was sie von den meisten Dirigenten unterscheidet: «Ich bin jung, eine Frau und Mexikanerin.»
Am interessantesten ist der letzte Punkt, denn für Alondra de la Parra ist ihre Herkunft auch eine Aufgabe. Mit 23 Jahren gründete sie ein Orchester, das junge süd- und nordamerikanische Musiker*innen zusammenbringt. Vor einem Jahr folgte die Gründung eines mexikanischen Klassik-Festivals. Und immer wieder setzt sie mexikanische, südamerikanische oder südamerikanisch inspirierte Werke auf ihre Programme – auch bei ihrem nächsten Zürcher Auftritt: Beim Silvesterkonzert wird sie Musik von Piazzolla und Chávez mit Gershwins «Cuban Overture» und Ausschnitten aus Bernsteins « West Side Story» kombinieren.
Es ist ihr fünfter Auftritt mit dem Tonhalle- Orchester Zürich, einem von über hundert Orchestern in 27 Ländern, die sie in ihrer bisherigen Karriere dirigierte. Und nicht nur geografisch, sondern auch künstlerisch sucht sie einen weiten Radius: etwa mit der interdisziplinären Performance «The Silence of Sound», in der sie sinfonische Musik, eine Clownin und Video-Installationen zusammenbringt.
Auch eine poetische Ader hat Alondra de la Parra. Das zeigt ihre Antwort auf jene Frage, über die Joana Mallwitz lieber nichts mehr sagen würde: «Wenn ich am Dirigentenpult stehe, dann bin ich eine Frau, ich bin aber gleichzeitig auch ein Mann, ich bin ein Kind, ich bin ein Sonnenuntergang, ich bin ein Berg, ich bin Feuer, Energie, Stärke, Geschwindigkeit, ich bin eine ganze Welt, die die Musiker in mir entdecken können – und ich entdecke eine ganze Welt in ihren Augen.»
Tatsächlich: Spätestens mit dieser Formulierung hat sich das Thema «Dirigentin» endgültig erschöpft.