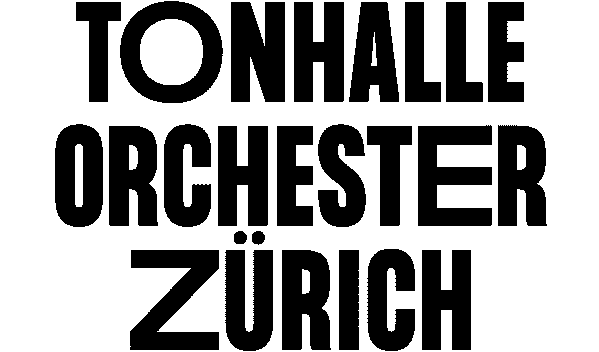Der Bogen macht die Musik
Es ist der Traum vieler Geiger*innen, eine Stradivari oder Guarneri zu spielen. Doch den Zauber entfacht nicht selten erst der richtige Bogen – wie auch unsere Konzertmeisterin Julia Becker weiss.
Wenn es um wertvolle Instrumente geht, ist man schnell bei den Meistergeigen. Eine der teuersten Violinen ist die «Lady Blunt» Stradivari, die im Jahr 2011 in London bei einer Wohltätigkeitsauktion für Japans Erdbebenopfer für 9,8 Mio Pfund Sterling (ca. 11 Mio CHF) versteigert wurde. Getoppt wird sie wohl nur von der Guarneri «Vieuxtemps », die 2012 einen Preis von 16 Mio US-Dollar (ca. 14,6 Mio CHF) erreichte.
Ein Meisterbogen zur Meistergeige
Zugegeben, in solchen finanziellen Sphären ist man mit den Geigenbögen aus Meisterhand nicht unterwegs. Und doch kann man für einen alten Meisterbogen problemlos 20’000, 50’000 oder 100’000 CHF bezahlen. Der Rekord für einen Tourte-Bogen liegt aktuell bei 570’000 Euro (ca. 535’000 CHF). Wenn man bedenkt, was ein durchschnittlicher Bogen kostet, ist das schon eine beachtliche Spanne.
Viel wichtiger ist aber der Gedanke, dass ein guter Bogen einem Instrument erst seine eigentliche Stimme entlocken kann. Oder, noch pointierter, mit den Worten des Geigenvirtuosen Giovanni Battista Viotti (1755–1824) ausgedrückt: «Le violon, c’est l’archêt» – «Die Violine, das ist der Bogen». Damit war einerseits die Spieltechnik gemeint, denn Viotti hat das moderne Geigenspiel geprägt. Doch andererseits bezog er sich durchaus auf jenes Zubehör zum Instrument, das häufig weniger Beachtung findet. Viotti gab wertvolle Hinweise für eine regelrechte Revolution: Denn die unverkennbaren Bögen des französischen Bogenbauers François Xavier Tourte (1748–1835) läuteten eine neue Ära ein und haben bis heute Vorbildwirkung. Nicht ohne Grund wird er auch als «Stradivari des Bogens» bezeichnet.
Die französischen Meisterbögen
In der Zeit, als Tourte geboren wurde, um 1750, entwickelte sich das Spezialhandwerk, das er selbst perfektionieren sollte: Das Bogenmacherhandwerk trennte sich vom Geigenbauhandwerk. Schon Vater und Bruder waren Meister im Bogenbau. Die ersten Arbeiten von François Xavier Tourte zeigen noch deren Einfluss; so waren etwa die Stangen noch rund, ab 1805 dann charakteristisch oktogonal und aus Fernambukholz. Ausserdem brachte er Neuerungen ein, die sich im Nachhinein als idealtypisch erwiesen.
So dokumentierte sein Schüler Jean-Baptiste Vuillaume (1798–1875), dass die Verjüngung des Querschnitts der Bogenstange mathematischen Gesetzmässigkeiten entspricht. Vor allem bietet der Bogen auf diese Weise eine enorme Elastizität. Der Frosch aus Ebenholz erhielt von Tourte ebenso seine heutige Form wie der Bezug aus Rosshaar – zuvor gebündelt, wird er seither als Band gleichmässig und breiter verteilt. Ausserdem erwiesen sich die Masse seiner Bögen, was die Gesamtlänge sowie die Abstände zwischen Bezug und Stange angeht, als optimal für die spieltechnischen Ansprüche. Entsprechend begehrt sind die Originale von Tourte, aber auch jene der französischen Schule um und nach Vuillaume: Peccatte, Simon, Lamy Père und Voirin sind klingende Namen, wenn es um Bögen geht.
Das Geheimnis
Unsere Konzertmeisterin Julia Becker spielt einen Tourte-Bogen – eine Leihgabe. Dass sie ihn noch immer benutzen kann, ist ein glücklicher Zufall, wie sie erzählt: «Dieser Bogen gehörte zu der Stradivari, die ich 20 Jahre lang gespielt habe. Die Geige musste ich vor ungefähr sechs Jahren abgeben, aber den Bogen durfte ich behalten. Und ich weiss noch ganz genau, wie mein Geigenbauer Markus Ramsauer damals gesagt hat: ‹An deiner Stelle wäre ich erleichtert! Denn den Bogen herzugeben, wäre noch ein viel grösserer Schritt gewesen als die Geige.› Das stimmt! Denn so ein Bogen passt entweder zu einer Hand oder eben nicht. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass dieser Bogen absolut zu mir passt.»
Doch was heisst das genau? Was ist das Geheimnis eines solchen Bogens? Im Gespräch mit Julia Becker wird klar, dass es in ihrem Fall die Vielseitigkeit ist. Und dass er genau zum Repertoire eines Sinfonieorchesters wie dem Tonhalle-Orchester Zürich passt: «Ich mag diese unglaubliche Flexibilität. Ich bin sehr froh, dass ich den Bogen nicht wechseln muss für verschiedene Werke aus verschiedenen Epochen. Und ich liebe die Differenzierung, die ich erreichen kann, je nachdem, ob ich viel Bogen benutze oder wenig. Bei einem Mozart-Konzert kann ich das Filigrane herausbringen, aber dann bei Tschaikowsky oder Bruckner auch einen wirklich fetten Sound. Beim Spiccato ist das besonders zu spüren. Da habe ich einen richtig guten Zugriff auf die Saite.»
Meisterbogen oder Carbon?
Die logische Schlussfolgerung wäre: Ein Bogen, der alles kann, ist immer im Einsatz. Aber gerade am Anfang hatte Julia Becker Zweifel: So einen wertvollen Bogen werde sie sicher nicht im Orchester spielen. Viel zu schade. «Irgendwann habe ich doch angefangen, ihn im Orchester zu verwenden. Inzwischen spiele ich ihn ausschliesslich. Ausser er hat zu viele Haare gelassen. Dann kommt tatsächlich mein Ersatzbogen zum Einsatz.»
Es gibt ihn also – den Ersatzbogen bzw. die Ersatzbögen. Insgesamt habe sie sieben davon: «Fünf richtige und zwei aus Carbon.» Doch wie können die Ersatzbögen neben dem Superlativ- Bogen bestehen? Gut, meint die Konzertmeisterin. Denn alle Varianten haben ihre Berechtigung: «Der Ersatzbogen, den ich immer dabeihabe, ist ein moderner Grünke. Den habe ich mir gekauft, als ich in Bayreuth gespielt habe. Das ist bestimmt 25 Jahre her. Ich habe damals 5’000 Mark dafür bezahlt. Den spüre ich viel mehr als zum Beispiel einen wertvollen französischen Bogen, den ich mal meinem Vater abgekauft habe. Ein edles Stück. Aber er ist mir ein bisschen zu flatterig.»
Bleiben noch die Carbonbögen. Leicht, robust, aber – seelenlos? So das häufige Vorurteil. Warum sich zwei Exemplare davon in der Ausstattung von Julia Becker finden, hat zwei Gründe: Reisen und zeitgenössische Musik. Bei beidem wäre das Risiko zu gross, dass der Tourte-Bogen zu Bruch geht – sei es beim Transport oder durch Spielanweisungen: «Mit dem Carbonbogen kannst du alles machen, kratzen oder mit der Stange schaben. Kein Problem.» Bei Reisen ins Ausland, zum Beispiel in die USA, kommt der alte französische Bogen ebenfalls nicht in den Geigenkasten.
Dabei geht es auch um Zoll- und Einfuhrbestimmungen. Seltene Materialien wie Schildpatt oder Elfenbein, die früher verbaut wurden, sind heikel; es wurden schon Bögen am Zoll direkt zerbrochen. Fernambuk steht trotz entsprechenden Vorschlägen derzeit nicht auf der Liste der geschützten Hölzer, aber sicher ist sicher: «Wenn ich unterwegs solo spielen müsste, würde mir die Entscheidung gegen den Tourte jedoch schwerfallen. Ich bin ja schon froh, wenn ich ihn nach dem Bespannen zurückbekomme. Denn eigentlich kann ich nicht ohne ihn sein.»