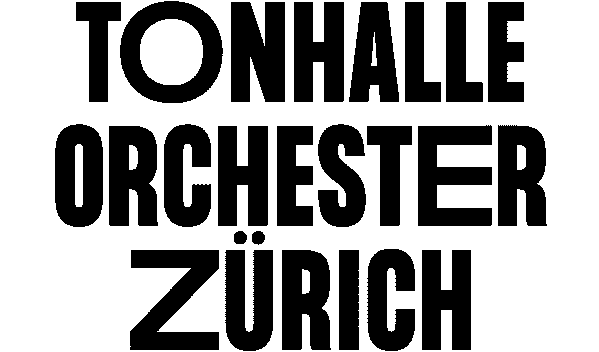Säule einer Sprache für alle
Mio Yamamoto spielt seit mehr als zwanzig Jahren bei den zweiten Geigen des Tonhalle-Orchesters Zürich. Ein Gespräch über Wurzeln und Weitblick, über Systemrelevanz und über den besten japanischen Koch dieser Stadt, die Mio längst zur Heimat geworden ist.
Mio Yamamoto rührt in ihrem Cappuccino und spricht leise, mit Bedacht. Ihr Zürcher Dialekt lässt darauf schliessen, dass die gebürtige Japanerin schon lange in der Schweiz lebt: Seit 21 Jahren. Sie ist mit ihren Eltern und der älteren Schwester in Osaka aufgewachsen, beide Töchter haben Geige gespielt, Mio allerdings besser, weshalb ihr die Schwester ihr wertvolleres Instrument hat abtreten müssen. Mio lacht: «Das war nicht nett von meinen Eltern.» Die Mutter lebt schon lange nicht mehr, der Vater ist kürzlich nach langer Krankheit verstorben. Wie gerne hätte Mio ihre Schwester im April besucht, jedes Jahr fliegt sie mit ihrer 12-jährigen Tochter und dem 15-Jährigen Sohn nach Japan, diesmal fiel die Reise dem Lockdown zum Opfer. Sie plant nicht und glaubt nicht daran, dass sie bald buchen kann. So sehr ihr Japan fehlt, ihre Schwester, die Freunde: «Mein Zuhause ist Zürich, hier habe ich Wurzeln geschlagen». Man sehe es ihr nicht an, «leider» – betritt sie ein Geschäft oder ein Café, sprechen die Leute sie auf Englisch an und bleiben meist auch dann dabei, wenn sie Schweizerdeutsch antwortet. Das sei zwar höflich gemeint, aber es tue immer ein bisschen weh, sagt Mio: «Es erinnert mich daran, dass ich nie ganz hierhergehören kann», dass Menschen eben doch in Schablonen denken, dass Herkunft mit Sprache verknüpft wird, auch wenn sie am ersten Tag in der Schweiz damit begonnen hat, nicht nur die Sprache, sondern eben auch den Dialekt zu lernen. In Osaka spreche man auch einen starken Dialekt, sie hat Mundarten gern, sie verorten sie und lösen ein Wohlgefühl aus: «Heimälig», sagt sie, auch wenn das nur Annäherungsversuche seien.
Allein am Pult in guter Gesellschaft
«Die einzige Sprache, die alle Menschen verstehen, ist die Musik» sagt Mio. «Alle anderen muss man lernen, man muss übersetzen, um zu verstehen.» Musik sei universell, und sie gebe Gefühlen einen Klang. Der Liebe, der Wut, der Angst. Das hat Mio an den spontanen Konzerten in den Altersheimen erneut erlebt, als sie wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen aus dem Orchester vor offenen Fenstern musizierte, um den Menschen in ihrer Isolation eine Freude zu bereiten: «Die Rückmeldungen haben mich tief berührt.»
Die erste Fremdsprache, die Mio lernte, war Italienisch und zwar, um dieser universellen Sprache, der Musik, auf den Grund zu kommen. Diesen Beschluss fasste sie, nachdem sie mit ihrer Schwester als 18-Jährige Geigenstudentin in Tokio die erste Europareise angetreten hatte. Die Beiden flogen nach Paris, fuhren nach Avignon, wo Mio allein bis Rom weiterreiste. Hier wollte sie leben: Die Kultur, die Musik, die Lebensfreude. Die Sprache! Italienisch war Musik in Mios Ohren, ohne viel zu verstehen, verliebte sie sich in den Klang. Sie kam nun jeden Sommer nach Rom zurück, für Meisterkurse, für Wettbewerbe. Bald fand sie einen Lehrer, bei dem sie erst zwei Jahre nach ihrem Abschluss in Tokio hätte studieren können. Das dauerte ihr zu lange, unbedingt wollte sie sofort nach Europa, dahin, wo die Musik herkommt, die sie liebt. Und so zog sie zu einer ehemaligen Studienfreundin nach Winterthur, lebte da auf dem Sofa, bewarb sich und spielte ein Jahr bei den Symphonikern in Hamburg und beschloss im folgenden Sommer ohne Sonne gegen Süden zu weiterzuziehen. Wieder hat es nicht Rom sein sollen: Das Tonhalle-Orchester Zürich lud sie zum Probespiel und engagierte die damals 26-Jährige Mio, die heute 47 ist.
Zurzeit bereitet sie sich auf die Saisoneröffnung mit Paavo Järvi vor, Beethoven, Pärt. Im Orchester hat sie ihren Platz unter den zweiten Geigen inne, sie fühlt sich dort ideal aufgehoben: «Ich bin lieber Fundament», Mio deutet auf die Säule unter der Marmorplatte des Bistrotischs, «ich fühle mich wohl damit, Basis zu sein». Jetzt sitzt sie allein an ihrem Pult wie alle Streicherinnen und Streicher, so sieht es das Corona-Sicherheitskonzept vor. «Es ist so schwierig», sagt sie. Es brauche viel mehr Energie, um zusammenzukommen, zudem müsse das Notenblättern geregelt werden, damit keine Lücken entstünden. Und doch ist sie dankbar, dass sie vor Publikum spielen kann, dafür nähme sie jede Hürde in Kauf. Der Lockdown hat sie verunsichert. «Wir fühlen, dass das Publikum so dankbar ist für die Livemusik wie wir es sind», man bekomme es zu hören, aber man fühle es auch direkt: Die Stimmung in den Konzerten sei aufgeladen, elektrisiert. «Dass die Politik gerade in dieser Zeit Kultur als nicht überlebenswichtig sieht, dass ihr der Weitblick fehlt, all die Künstlerinnen und Künstler nicht stärker zu stützen, die nicht wie ich festangestellt sind und jetzt in einer existentiellen Notlage sind, das verstehe ich wirklich nicht.» Musik könne heilen auf viele Arten, sie sei somit systemrelevant.
Kochen wie der Namensvetter an der Langstrasse
Was Mio aus der Zeit vor Corona nicht vermisse, sei diese Küsserei zur Begrüssung, die nun wegfalle. Ein bisschen unschweizerisch sei sie wohl doch geblieben. Sie kocht fleissig, damit Japanische Küche auf den Tisch kommt, die sie so vermisst. Zum Glück gebe es das Kokoro an der Neufrankengasse bei der Langstrasse: Da kocht ein Mann, der auch Mioh heisst, mit einem H am Ende zwar, aber dafür fantastisch, wie man es über Mios Küche sagen hört. Hierher bringt sie Musikerinnen und Musiker und allerhand andere Leute aus ihrem Leben mit. Küsschen hin oder her: Mio ist hier vernetzt und zuhause. Wer weiss, vielleicht lenkt Japan irgendwann ein, und sie kann den Schweizer Pass annehmen ohne den Japanischen abgeben zu müssen. «Heimälig» jedenfalls fühlt sie sich in ihrem Orchester als tragende Säule einer Sprache für alle.