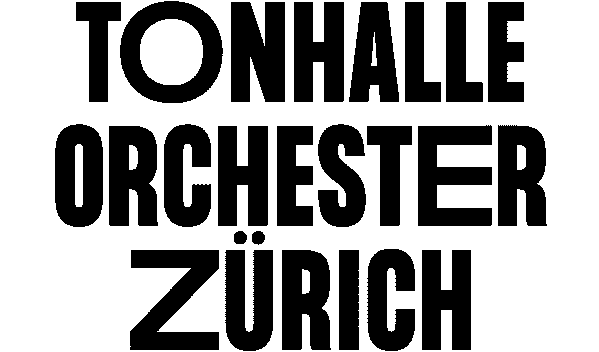Übe, mein Sohn
Filipe Johnson ist angekommen. So dürfe es bleiben, sagt er und auch, dass er auf der Geige noch viel zu lernen habe. Von einem, der spät begann und früh wusste, was er will.
Vor der Tonhalle Maag steht seit zwei Jahren ein Elektromobil. Es gehört Filipe Johnson, einem der neueren Mitglieder des Tonhalle-Orchesters Zürich, der nun seinen festen Platz in der ersten Geige innehat. Er kommt früh morgens, will sich in Ruhe einspielen und abends, wenn Proben und Konzerte vorüber sind, dann fährt er mit dem Mobil durch die Wälder oberhalb Zürichs, heimwärts Richtung Benglen in Fällanden. 80 Kilometer pro Stunde schafft sein Gefährte, eine gute Geschwindigkeit: Zu viel Lärm und zu viel Tempo wolle er sich vom Leib halten. «Zum ersten Mal fühle ich mich wohl und will nicht weg», sagt er. «Zum ersten Mal gelingt es mir, im Moment zu bleiben.»
Es war eine unruhige Zeit, die Filipe Johnson nach Zürich getrieben hat, und es ist eine rasante Geschichte, die er erzählt. Rasant vielleicht deshalb, weil sie spät in seinem Leben einsetzt, wie er findet: «Spät für einen, der zu den Allerbesten will», habe er doch erst mit fast 15 Jahren begonnen, Geige zu spielen. Oft genug hat er es gehört, in jungen Jahren, dass er alt sei. «Übe, mein Sohn», wiederholte sein Professor wie ein Mantra. «Üben bringt vielleicht Geld.» Geld fehlte bislang, eine Geige war zu teuer für seine Musikerfamilie, aber Filipe wollte nichts sonst, nur Geige spielen.
Und so beginnt er seine Geschichte mit dem Zeitpunkt, zu dem ihm sein Onkel eine Geige schenkte. Sie beginnt in Recife, einer grossen Stadt am Meer in Brasilien. Sein Weg hierher führte hin und zurück, immer wieder. Zum Beispiel nach Granada in Spanien. Von da aus jeden Monat nach Madrid, zehn Stunden im Bus und weiter per Flugzeug nach Bergamo und dann im Zug nach Cremona, spielte, reiste wieder nach Spanien, wo ein Freund ihn beherbergte, und übte, sechs oder acht Stunden am Tag. «Noch heute ist ein Tag ohne Üben kein erfüllter Tag», sagt er, wahrscheinlich sei er süchtig.
Dem Klang hinterher
In Cremona bezahlte ihm eine Stiftung Unterricht, bis er Stunden verpasste. Fortan wurde ihm der Zustupf gestrichen. Dabei verpasste er die Stunden, weil ihm das Geld für einen Flug fehlte. «Das war die Zeit der schlaflosen Nächte», sagt Filipe heute, «ich war getrieben.» Jetzt sitze er in einem Orchester, das ihn ins Jetzt hole. Hier messe man sich an sich selbst und nicht am Pultnachbarn, auch wenn der, wie das gesamte Orchester, in seiner Professionalität ein grosser Ansporn sei. «Ich bin glücklich wie nie zuvor.»
Zuvor war immer wieder Brasilien, wo er seinen Professor einmal als Solist hörte und wusste, dass er ihm überall hin folgen würde, diesem Klang, für den Filipe die Worte fehlen. Auch nach Lausanne, ohne zu wissen, welche Sprache er da sprechen und wie er leben würde. Er schloss also in der Schweiz sein Studium ab, spielte Trio, spielte Solo und auch in Orchestern.
Ordnung mit Zündschnur
Zuvor, das war zuletzt in Bern, da gab es Unstimmigkeiten innerhalb seines Registers. Und so war es mehr ein Gefühl der Erleichterung als eines der Freude, als er hier aufgenommen wurde. «Weil ich wusste, dass ich nicht zurück muss, und dass ich ein grosses Ziel erreicht habe.»
Ihm folgte seine Schwester, eine Bratschistin, die gerade den Master abgeschlossen hat. Mit ihr führt er eine Musiker-WG, die Beiden üben nebeneinander, kochen einfaches Essen, um nicht zu viel Zeit zu verlieren, und wenn doch Zeit bleibt, dann backen sie Kuchen. Zum Beispiel einen brasilianischen Hochzeitskuchen für eine Feier im Orchester, getränkt mit Wein und Zucker, oder sie schauen sich brasilianische Comedy im Internet an. Seine Schwester besucht jedes seiner Konzerte, für sie fühlt er sich umgekehrt verantwortlich, seit er 17-jährig beschlossen hat, nicht mehr mit seinem Vater zu sprechen. Zu schlecht habe der seine Mutter behandelt. Sie lebt in Portugal und kommt her, so oft es geht. «Meine Mutter liebt die Schweiz», sagt Filipe, «wir alle drei.» Ein bisschen komme ihm das Land zwar schon vor wie die Welt der Sims, einem Computerspiel, in dem alles seine Ordnung sucht. Sie seien halt Latinos. Immer mal wieder durchbricht das Temperament die Ruhe: «Meine Schwester hat eine extrem kurze Zündschnur, wie man in Brasilien sagt.»
Gefragt, was ihm denn seine neu gefundene Ruhe gebe, erzählt er vom Sport, vom Fitnesscenter und vom Schwimmen im Greifensee, denkt nach und sagt: «Wer du bist, was du bisher tatest, das scheint in diesem Orchester nicht wichtig zu sein. Was zählt, ist die Musik.» Filipe schaut auf die Uhr und verabschiedet sich höflich Richtung Elektromobil. Es gebe für ihn noch viel zu lernen auf seiner Geige.