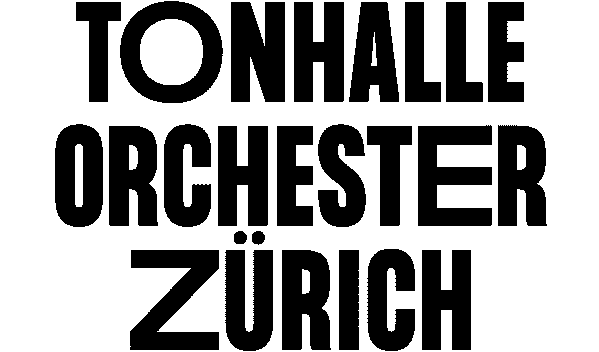Im Fieber für den einen Klang
Seine Brille leuchtet rot aus den Reihen der Zweiten Geige heraus. Filippo Maligno schwärmt von seinem Register, seinem Orchester überhaupt: Manchmal glühe der Klang schier, so warm sei er, ohne jede Spitze. Strukturiert und uneitel klinge das – so wie er klingt, Filippo selbst.
Seine Pizza mag er mit dickem, luftigem Teigrand, er führt es mit einem zentimeterdicken Luftloch zwischen Daumen und Zeigefinger vor, nicht dünn wie daheim: Filippo Maligno, der Römer mit der roten Brille. Seit bald drei Jahren gehört er zu den Zweiten Geigen im Tonhalle-Orchester Zürich.
Seine Pizza also mag er aus Napoli und seinen Geigenbauer aus einem Dorf nahe Ancona. Erst vergangenen Sommer hat er ein neues Instrument erstanden: Seither jagt ein Schreckensmoment den nächsten, weil er in ständiger Bange um seine schöne Violine lebt. Man habe ihr nun immerhin 90 Jahre lang Sorge getragen, sie habe Kraft und sei ein Schatz, wehe, er lasse sie nun liegen in einem unachtsamen Moment.
Pinselstriche, fliessend weich
Ansonsten scheint ihn, selbst erst 33, wenig aus der Ruhe zu bringen. Kein Fototermin, der aus technischen Gründen kurz vor Konzertbeginn scheitert, keine fiese Erkältung, bevor gleich Paavo Järvi Tschaikowskys Sechste dirigieren wird. Keine Zeit drängt, wenn er von ihm schwärmt: «Er zeichnet den Klang, als würde er einen Pinsel in der Hand halten», Filippo ahmt die Gesten des Dirigierens nach, «seine Bewegungen sind fliessend und weich, er kann sie in Musik übersetzen, alle im Orchester verstehen sofort.» Und er zeichne in vielen Farben, da gebe es Schattierungen, die weit kontrastreicher seien als laut oder leise. Er war noch nicht da, als David Zinman mit dem Orchester gearbeitet hat, aber er ist sich sicher: «Das Bewusstsein über horizontalen Klang lernt man als Orchester nicht über Nacht, das scheint hier so ausgeprägt, es muss die Herkunft sein.» Und Paavo Järvi eben wisse diese zu nutzen: «Ich habe diesen Klang so nie gehört, diese gleichmütige Wärme, die Struktur hat und doch auf eigentümliche Weise uneitel ist.» Uneitel, unaufgesetzt, so wirkt auch Filippo trotz, oder vielleicht auch wegen der Begeisterung, die er versprüht. Sie überträgt sich auf die Menschen um ihn, sein Charme trägt dazu bei. Das kommt auch im Orchester gut an: «Sie sagen, ich sei die Sonne aus Italien», sagt Filippo so, als möchte er es besser wieder zurückziehen, dieses Kompliment für sich behalten, lächelt sein sonst so breites Lächeln bescheiden. Ohnehin scheint er bestens verankert im Orchester: Montags geht er mit dem Cellisten Benjamin Nyffenegger fussballspielen. Mit seiner Freundin wohnt er in jener Wohnung in Wollishofen, in der sein Geigerkollege Chris Whiting während fast 20 Jahren zuhause war. Nach Zürich geholt hat ihn sein Lehrer Klaidi Sahatçi, einer der Ersten Konzertmeister des Orchesters. «Klaidi motivierte mich dazu, in Zürich zum Probespiel anzutreten, als ich bei ihm in Lugano studierte», sagt Filippo, der Studium an Studium hängt, obwohl er bereits mit 17 Jahren eine Festanstellung im Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza erhielt. Der Stimmführer der zweiten Geigen der Berliner Philharmoniker, Christophe Horák, unterrichtete ihn später in Berlin, vier Jahre lang und vier kalte Winter, Filippo erinnert sich und lacht, dann zog er ins Tessin. Nach seinem Master bei Klaidi beschloss er, sich weiter unterrichten zu lassen: Bei Nora Chastain an der Zürcher Hochschule der Künste, die ihn bis heute auf seinem Weg begleitet.
Von Queen zur Klassik
Seine erste Förderin war Filippos Mutter. Seine Karriere begann mit vier, als sein Kumpel, älter und beeindruckend, Geigenunterricht nahm. Der hörte bald wieder damit auf, aber Filippo machte weiter. «Nicht, dass ich nie aufhören wollte», sagt er, «es ist ja ein so fordernder Weg.» Erst klinge man grässlich während Jahren. Seine Mutter hat das ausgehalten, hat ihn angetrieben. «Sie war streng, wenn es ums Üben ging, weil sie an mich glaubte.» Heute sei er ihr unendlich dankbar dafür, dass sie seine Musikalität erkannte, als er als ganz kleiner Junge Songs von Queen sang, ohne ein Wort zu verstehen. Es scheint ihm wie eine Legende, die sie ihm immer wieder erzähle.
Fordernd sei der musikalische Weg deshalb weitergegangen, weil er so viel Ellbogen brauche, die Filippo eigentlich gar nicht zeigen will: «Immer dieser Wettbewerb». Aber er kann nicht anders, ist «furchtbar verliebt in diese Arbeit», das Feuer lasse nicht nach. Und immer, wenn ein Projekt vorüber sei, falle er um, bekomme Fieber. Er sagt es, putzt die rote Brille und seine Nase, dann macht er sich auf zu Paavo Järvi und zu Tschaikowskys sechster Sinfonie.