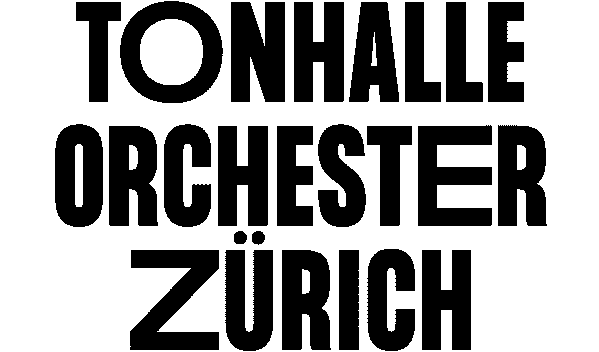Hand, Fuss und Herz im Gleichschlag
Andreas Berger ist Solo-Schlagzeuger im Tonhalle-Orchester Zürich. Dem guten Musiker sei das Notenblatt des Spitzenkochs Stück Fleisch. Technik und Timing seien Grundzutaten. Erst Respekt und eine Prise Zärtlichkeit aber ergäben im besten Fall Musik.
Zwei Finger klopfen mit Leichtigkeit komplizierte Rhythmen neben ein Glas, das Andreas Berger in einem Zug geleert hat. Die Sonne drückt auf die Tische der Rivington Bar neben der Tonhalle Maag. «Alles ist Rhythmus», sagt er, seit 1994 fest angestellter Solo-Schlagzeuger im Tonhalle-Orchester Zürich. Er scherzt in gemächlichem Bernerdialekt mit Musikerinnen und Musikern, mit Leuten der Geschäftsleitung und der Billettkasse, mit allen, die vorbeispazieren. «Alles ist Rhythmus, der Absatz auf dem Fussboden, das Stolpern, das Hinken.» Ein Kind wirft Steine zu Boden. Auch das: Rhythmus. Das Atmen, die Atemlosigkeit.
Andreas entwickelt Rhythmen weiter, ständig, oft unbewusst. Sein Oberkörper im Tanktop, tätowiert und muskulös, will nicht zum verschmitzten Kerl passen, der er ist, zu seinem spitzbübischen Wesen. Er dreht und wendet seine Worte mit Bedacht, um sie im nächsten Moment als bedeutungslos zu verwerfen und über sich selbst und die Welt um ihn herum zu lachen. Ein «oberintellektueller Überkünstler» sei er jedenfalls keiner, die Muskeln aber vor allem Resultat eines intensiven Trainings während des Corona-Lockdowns – irgendetwas habe er schliesslich tun müssen. Klar, hat er im Keller seines Hauses in Birmensdorf geübt, seine «tägliche Hygiene» durchexerziert, aber immer nur ohne Orchester, da fehle jede Würze im Leben eines Musikers. Auch fehlen ihm die Essenden am Tisch, sein Publikum: Die geteilte Freude, die Versunkenheit. Küchenmetaphern mag Andras lieber als das Kochen. Schon eher sei er ein guter Esser, zeitweise habe er das exzessiv betrieben als Gourmetbummler durch die besten Lokale weit und breit. Kochen für sich allein, das sei ihm zu fad.
Dem Ohr das Timing abverlangen
In die Küche führen Anekdoten aus Andreas' Kindheit im Bernischen Uetendorf: Kein Topf konnte man vor ihm verstecken, keine Kelle und keinen Schwingbesen. Alles war ihm Instrument und seine Eltern dankbar, als sie ihn mit sechs Jahren endlich in die Musikschule nach Thun schicken konnten. Aber richtig los ging es erst, als er endlich Hände und Füsse kombiniert in Einsatz bringen konnte am Drum Set, die verflixte Unabhängigkeit der Gliedmassen in den Griff bekam. Das ewige Trommeln mit einer Hand, das sei für Kinder nicht das Gelbe vom Ei.
Ins Schwärmen gerät Andreas noch heute mit 51, wenn er von seiner Zeit bei den Tambouren und deren Tradition erzählt: Vom Proben im Sommer auf Trommeln für die Umzüge, im Winter drinnen mit Plastikböcken wegen der Lautstärke. «Sehr zu Recht werden wir für diese ganz eigene Welt bewundert im Ausland.» Das gebe Boden für einen guten Schlagzeuger, überhaupt für Musikerinnen und Musiker, Übung und Erfahrung. Ein Vorsprung für Schweizer und jener Völker, die eine ähnliche Kultur kennen würden. Dass zählen und zuhören zur Musik führen, das habe er dort gelernt. Was banal klinge, sei die Essenz seiner Kunst: Das Zuhören so zu verinnerlichen, dass man die Zeichen kommen höre, immer einen Augenblick voraus, dass man mit der Musik gehe und sie so erst erschaffe. Das Resultat jahrelanger Arbeit eben.
Wildes Tier in der grossen Stadt
Andreas' musikalische Jugendjahre verliefen glatt und rasant. In Uetendorf sei man bald der beste Schlagzeuger, in Thun vielleicht auch. Noch in Bern fiel sein Können den deutlich älteren Kolleginnen und Kollegen am Konservatorium auf. «Du musst weiterziehen», haben sie ihm gesagt, «geh nach München zum Geschwendtner.» Hermann Gschwendtner galt als bester Lehrer seinerzeit, und so schrieb ihm Andreas einen Brief, den jener mit einer Einladungskarte beantwortete. Er war sechzehn, gerade hatte er seine Lehre als Maschinenzeichner begonnen, dennoch fuhr ihn sein Vater hin. «Du spielst dich ein, ich komme zurück», habe Geschwendtner gesagt und ihm bei der Rückkehr ins Zimmer als Schüler aufgenommen. Die vorbereiteten Stücke wollte er gar nicht mehr hören, dafür gab er ihm einen Stapel Hausaufgaben mit auf den Weg und bestellte Andreas jedes Jahr zu sich, weil der sagte, er habe jetzt noch keine Zeit für die Hochschule: «Musigen ohne Lehrabschluss? Das kam nicht in Frage.» Hätte sein Lehrer dies nicht geduldet, wäre Andreas heute wohl Ingenieur, wie sein Vater. Aber morgens in die Tonhalle Maag zu kommen, das sei eben nicht in die Werkstatt kommen, so gern er auch dort war. Der Konzertsaal ist ihm nie nur Arbeitsplatz gewesen.
Man möchte meinen, dass einer wie er sich spielend leicht hochgearbeitet hat. Das ist gefehlt. «Du musst hart sein mit dir», sagt er. Schon neben der Lehre habe er geübt wie ein getriebenes, wildes Tier. «Tonsatz und Gehörbildung, da war ich gelinde gesagt eine Katastrophe. Klavier das Selbe, um Himmels Willen.» Und als er schliesslich nach seinem Lehrabschluss in München angekommen sei, habe er von der Stadt ausserhalb seines Zimmers und der Universität kaum etwas wahrgenommen. «Das war nicht Uetendorf», wusste er, es war die Welt, seine Welt. Triangel, Marimba, die Becken, die Trommeln: Es gab viel zu lernen. Seinen Rückstand auf den einen Instrumenten seines Fachs machte er an der kleinen Trommel wett: Da spielt ihm keiner um die Ohren.
Pfeffer, Salz und Herzschlag
Er wisse es relativ rasch: Entweder, jemand bringe die Musikalität mit oder eben nicht. Manchmal komme sein Kollege Klaus Schwärzler aus einem Vorspiel an der Zürcher Hochschule der Künste zurück und sage: «Da ist einer, der wird 'ne Bombe.»
Um Andreas' Musikalität wusste man wohl an der Staatsoper Nürnberg, wo er mit Neunzehn seine erste Festanstellung erhielt, noch mitten im Studium. Eine kleine Sensation für einen jungen Schweizer sei das gewesen. Es folgten Tourneen mit grossen Orchestern, dann, eben 1996, die Einladung zum Vorspielen in Zürich. Hier will er nicht mehr weg.
Allein das Glück, in diesen Zeiten fest angestellt zu sein und dann noch in einem Spitzenorchester, mit den besten Dirigentinnen und Dirigenten, den begabtesten Solistinnen und Solisten zu musizieren, das sei für ihn nicht zu schlagen. Zudem pflege Paavo Järvi die Handschrift des Orchesters auf wunderbare Art: Weil er mehr verlange als technische Perfektion. Er verlange Timing, volle Aufmerksamkeit und Agilität. Er verlange Empathie und das gefällt Andreas, der eine Küchenmetapher zur Hand nimmt: «muss als guter Musiker wie ein guter Koch zärtlich und voller Respekt mit seinen Zutaten umgehen, sein Stück Fleisch sind unsere Noten.» Das brauche Erfahrung, das brauche aber vor allem auch Zuneigung. Herz. «Das Miteinander, das Gemeinsame, das ist meine Musik, jede Woche neu, egal, in welcher Besetzung, an welchem meiner Instrumente». Das sei ganz anders als in einer Band, da sei man als Schlagzeuger der treibende Motor. Im Orchester, da sei man als Schlagzeuger Pfeffer, Salz und vielleicht ein bisschen Herzschlag.